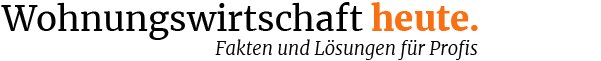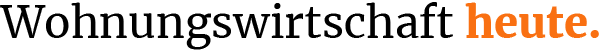Noch steckt die Kreislaufbauwirtschaft in den Kinderschuhen. In absehbarer Zeit soll sie der Normalfall sein. Für einige Pionier:innen und Vorreiter:innen ist sie das bereits.
FRANZISKA LEEB
„Noli turbare circulos meos“ – auf Deutsch „Störe meine Kreise nicht“, wies Archimedes, der berühmteste Naturwissenschafter der Antike, einen römischen Soldaten ab, der ihn daran hindern wollte, eine Aufgabe zu Ende zu lösen. Es waren seine letzten Worte.
Noch lang nicht die letzten Worte gesprochen sind bei der Etablierung einer Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Schon im Jahr 2015 hat die Europäischen Kommission den Aktionsplan „Circular Economy“ ins Leben gerufen. Im Dezember 2022 wurde die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie vom Ministerrat beschlossen, die Bauwirtschaft ist dabei eines der relevantesten Handlungsfelder.
Diesen Juni veröffentlichte das Bundesministerium für Klimaschutz den ersten Fortschrittsbericht über Österreichs Weg zu einer nachhaltigen und zirkulären Gesellschaft, der konkrete Aktivitäten und geplante Vorhaben zusammenfasst. Das darin nicht explizit formulierte, aber naheliegende Fazit: Es gibt viele Initiativen, aber – mit Ausnahme von Wien, wo bereits die wesentlichen Weichen gestellt wurden (siehe „Von außen betrachtet“, S. 34) – haben die Bundesländer noch ihre Hausaufgaben zu erledigen, um den Wandel in Richtung zirkuläres Bauen auf Schiene zu bringen.
Eine zirkuläre Bauwirtschaft geht weit über das Recycling hinaus. Kurz gefasst geht es darum, Ressourcen möglichst lange sowie mit wenig Verlusten in der Nutzung zu halten und Gebäude als Materiallager zu betrachten. Das bedeutet einen völligen Wertewandel im Bausektor und setzt neue Prozessabläufe voraus. Eine integrale Planung, die – unterstützt durch Building Information Modeling – Informationen über den gesamten Lebenszyklus dokumentiert, ein Management der Stoffströme auf der Baustelle und insbesondere die Langlebigkeit der Gebäude sind dabei wichtige Faktoren. Oft werden Gesetze und Normen als Hindernisse genannt.
„Eine noch größere Hürde sind fehlende Geschäftsmodelle“, erklärt Bernadette Luger, Leiterin der Stabsstelle Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Bauwesen in der Wiener Stadtbaudirektion.
Form folgt der Verfügbarkeit
Elektro- und Sanitärinstallationen aus zweiter Hand, Holzabfälle aus Tischlereien und andere Materialien aus Abbruchgebäuden, Lagerbeständen oder Orten, wo sie nicht mehr gebraucht wurden, sind die Stoffe aus denen das Interieur des Impact Hub im CRCLR-House (Circular Economy Haus) auf dem ehemaligen Areal der Brauerei Kindl in Berlin gemacht ist.
Wo keine wiederverwendeten Materialien eingesetzt werden konnten, kamen neue aus nachwachsenden Rohstoffen zum Zug, die nach Ablauf ihrer Zeit sortenrein getrennt werden können. Planer:innen des mehrfach ausgezeichneten und viel publizierten Projekts sind die jungen Architekt:innen des Berliner Büros LXSY, die angetreten sind, die Bauwende voranzutreiben. Das zirkuläre Bauen verändert die Arbeit, bestätigen die Gründerinnen Kim Le Roux und Margit Sichrovsky.
„Gemeinsam mit allen Beteiligten begibt man sich auf die Suche, wie sich innerhalb von Normen und Vorschriften gewohnte Abläufe verändern lassen“, beschreibt Kim Le Roux die Reise in die kreislauffähige Bauzukunft. Diese neuen Prozesse „bergen die Chance für neue Formen und Strukturen der Zusammenarbeit“, ergänzt Margit Sichrovsky.


Das Architekturmachen sei keine Einzelleistung. Handwerker:innen seien zunächst der Wiederverwendung von Bauteilen kritisch gegenübergestanden, räumt Kim Le Roux ein: „Aber Themen wie Materialknappheit, Lieferengpässe oder hohe Materialpreise haben sie dann überzeugt. In Prototyping-Workshops haben wir gemeinsam neue Lösungen entwickelt und dabei traditionelle Bauweisen neu entdeckt. Das zirkuläre Bauen kann dem Handwerk Qualitäten verleihen und damit das Berufsfeld attraktiver gestalten.“ Das Vorurteil, dass zirkuläres Bauen mit Abstrichen bei der Gestaltung einhergeht, teilen die beiden Architekt:innen nicht: „Vielmehr kann die Suche nach gebrauchten Materialien ein Designtreiber sein.“
Im größeren Maßstab um zirkuläre Bauweise und Bestandssanierung geht es beim Quartier „Der neue Stöckach“, einem derzeit ruhenden Projekt der IBA‘27 in Stuttgart, wo LXSY gemeinsam mit asp Architekten auf zirkuläre Bauweise und Bestandssanierung setzen.
Baukreislauf-Anleitungen
Im Zuge des Forschungsprojekts BuildReUse wurden drei Leitfäden entwickelt, in denen Grundprinzipien und Lösungsansätze für die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft am Bau dargelegt werden:
- Anna Maria Fulterer u.a.: Zusammenarbeiten in der Kreislaufbauwirtschaft, Graz 2024
- Daniel Orth, Markus Meissner u. a.: Bauteile rückgewinnen, Wien 2024 Lutz Dorsch,
- Simon Kindelbacher u. a.: Handbuch Konstruktionen planen, Kuchl 2024
Angewandte Forschung
Auf die Suche nach Kreislauf-Demoprojekten hat sich das vom Impact Hub Vienna betriebene Climate Lab gemacht. Im Projekt Kraisbau haben sich 32 Partner aus Bauwirtschaft, Planung und Forschung zusammengetan, um die Voraussetzungen für die Bauwende zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Integration von künstlicher Intelligenz, die helfen soll, skalierbare Lösungen im Umgang mit dem Gebäudebestand zu finden. Zudem werden technische und rechtliche Rahmenbedingungen analysiert, die Erkenntnisse der Branche zugänglich gemacht und anhand von Demonstrationsprojekten Grundlagen aus der Praxis für die Praxis erarbeitet.
Über das Forschungs- und Demo- Projektstadium hinaus ist man bei der Unternehmensgruppe Salzburg Wohnbau. „Wir wollen nicht mehr davon überzeugt werden, dass andere Methoden besser sind als die Kreislaufwirtschaft“, sagt Thomas Maierhofer, der mit Georg Grundbichler das neue Geschäftsführerduo bildet. Im Jahr 2021 initiierte das Unternehmen das Forschungsprojekt Cico (Circular Concrete), das gemeinsam mit der Bautechnischen Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg (bvfs), der Fachhochschule Salzburg, der Universität Salzburg und Deisl Beton umgesetzt und vom Land Salzburg gefördert wurde. Auf den Punkt gebracht ging es dabei darum, aus alten Gebäuden neue, kreislauffähige Bauten zu machen.
„Es gab genug, die uns belächelt haben“, erzählt Meierhofer. Mittlerweile vier Realisierungen beweisen, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Der Neubau der Volksschule Anif, in den der Beton des Bestands aus den 1970er Jahren eingearbeitet wurde, erhielt kürzlich den Energy Globe Award. Auch im vor der Fertigstellung stehenden Wohnbauprojekt DreiGang in Golling steckt – auch wenn man es nicht sieht – der Vorgängerbau, ein Seniorenwohnheim. Bei dessen Rückbau wurden 4.300 Tonnen an Recyclingmaterial gewonnen. Mehr als ein Drittel davon fand im Neubau Verwendung, darunter der alte Holz-Dachstuhl und 570 Tonnen Ziegel. „Es ist uns immer gelungen, die Güte- und Qualitätswerte einzuhalten“, räumt Maierhofer diesbezügliche Bedenken aus. Und die Kosten?
Bei den ersten Projekten seien im Hinblick auf die Qualitätssicherung überhöhte Prüfkosten entstanden, räumt Maierhofer ein. „Ansonsten sollte die neue Art des Bauens nicht zu Mehrkosten führen.“ Mehrwerte hingegen gäbe es viele, auch für das Employee Branding, weil man mit dem Thema die Belegschaft motivieren könne.
„Gib mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann und ich werde dir die Welt aus den Angeln heben“, auch das soll Archimedes gesagt haben. Ein paar Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Bauwende gibt es schon.