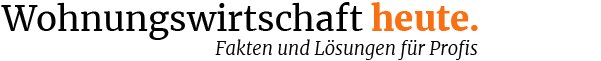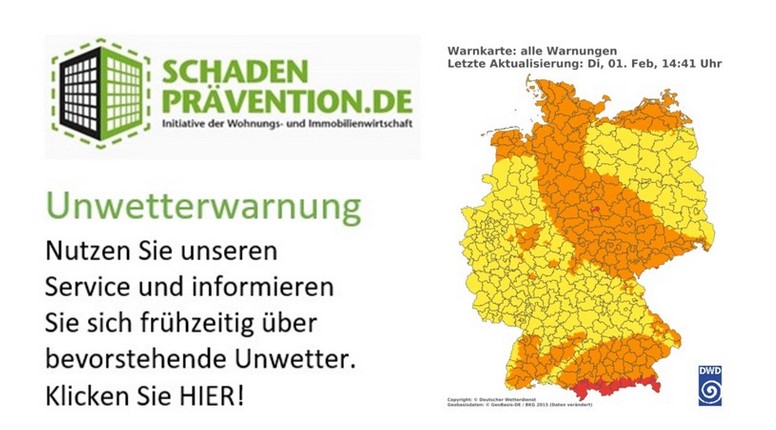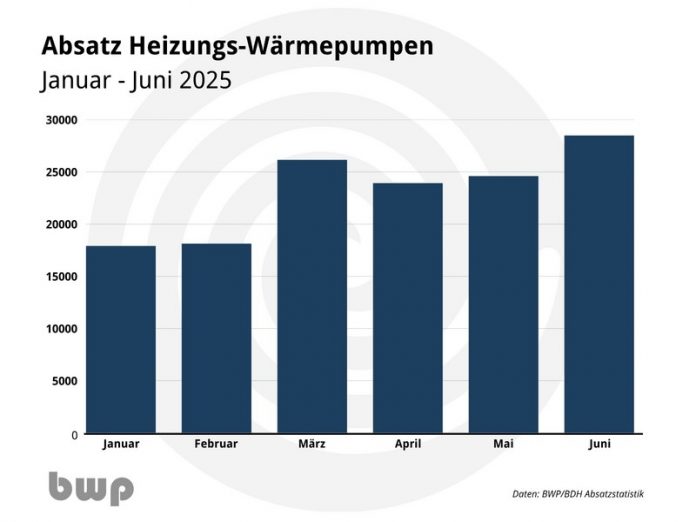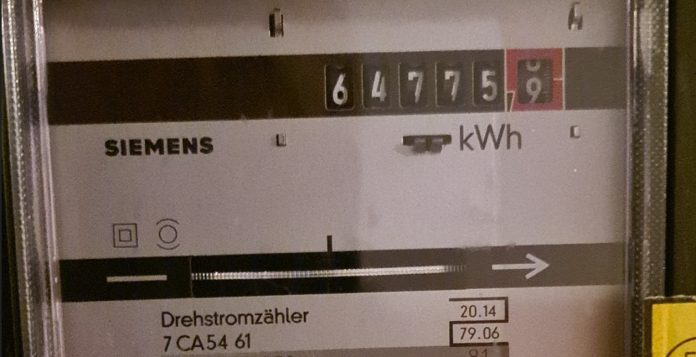Mit dem im August ausgerufenen Wettbewerb „WärmepumpenChallenge.MFH” zeichnet das Land Nordrhein-Westfalen übertragbare, praxistaugliche und effiziente Konzepte für Wärmepumpensysteme in Mehrfamilienhäusern aus. Drei Siegerprojekte hat die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz gemeinsam mit dem NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerium die gekürt.
Die klimafreundliche Wärmeversorgung von Mehrfamilienhäusern ist ein wichtiger Beitrag zur Wärmewende – besonders in Nordrhein-Westfalen, wo Mehrfamilienhäuser mehr als die Hälfte des Wohnungsbestands ausmachen. Mit der Auszeichnung der Konzepte der Indicamus GmbH aus Köln, der Vaestro GmbH aus Düsseldorf und der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH aus Werdohl im Märkischen Kreis will das Land standardisierbare Wärmepumpenlösungen sichtbar machen und so einen Impuls für die Wärmewende im Mehrfamilienbestand setzen.
Dr. Katharina Schubert, Geschäftsführerin von NRW.Energy4Climate: „Wir wollen der Wärmewende in Mehrfamilienhäusern einen Schub geben. Wärmepumpen sind eine äußerst effiziente und zukunftssichere Heizlösung, die in Nordrhein-Westfalen in mehr als jedem zweiten neugebauten Wohngebäude Einsatz findet. Im Mehrfamilienbestand sehen wir dagegen noch zu wenige innovative Wärmepumpenlösungen. Mit den Gewinnerkonzepten der ‘WärmepumpenChallenge.MFH’ wollen wir das ändern und zeigen, wie die Technologie trotz komplexerer Anforderungen auch hier standardisiert werden kann.”
Die Gewinnerkonzepte
Der Umstieg auf Wärmepumpen kann im Mehrfamilienhausbestand technisch anspruchsvoller sein als im Neubau oder in Einfamilienhäusern. Herausforderungen sind zum Beispiel begrenzte Aufstellflächen, enge Technikräume, erhöhte Installationsanforderungen durch dezentrale Bestandsanlagen, teils hohe Vorlauftemperaturen oder Hygieneanforderungen bei der Warmwasserbereitung. Oft sind Umrüstungen daher heute noch individuelle Einzellösungen, die mit erhöhtem Aufwand in Planung und Umsetzung verbunden sind.
Die drei Gewinner bieten nun unterschiedliche Lösungen an, die für Häuser ab sechs Wohneinheiten für die Nachkriegsbaujahre 1949 bis 1977 geeignet sind.
Eine der Auszeichnungen erhält das Bausachverständigenbüro Indicamus GmbH. Das Konzept für das Mehrfamilienhaus Nikolaus-Lenau-Straße in Bergisch Gladbach ersetzt Gasetagenheizungen durch ein zweistufiges Wärmpumpensystem mit zentraler Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe und dezentralen Wasser-Wasser-Mikrowärmepumpen. Ein digitaler Gebäudezwilling ermöglicht eine effiziente Lösung mit minimalem baulichem Aufwand. Das System senkt den Energieverbrauch und ist auch auf ähnliche Bestandsgebäude übertragbar.
Eine weitere Auszeichnung geht an die Vaestro GmbH. Das Gebäude in Bochum aus dem Baujahr 1958 wird mit einer zentralen Wärmepumpe und dezentralen Wohnungsstationen modernisiert. Vaestro investiert mit, betreibt die Anlage und sorgt für flexible Strombeschaffung sowie eine stabile Wärmeversorgung. Zusammen mit staatlichen Fördermitteln soll für die Mieterinnen und Mieter Kostenparität im Vergleich zu einem neuen fossilen Heizsystem erreicht werden. Moderate Sanierungen wie ein Austausch aller Heizkörper ergänzen das Konzept.


Der dritte Preisträger ist das teilkommunale Wohnungsunternehmen Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH mit dem Konzept zu ihrer Gebäudegruppe Breslauer Straße aus dem Baujahr 1952 in Werdohl-Ütterlingsen. Sie entwickelt standardisierte Lösungen mit Luft-Wärmepumpen, ergänzt um Bausteine wie ein einheitliches Heizungsmonitoring und ein Kommunikationskonzept für Bewohnerinnen und Bewohner. Alle Maßnahmen lassen sich auf die Mehrfamilienhäuser im Gebäudeportfolio übertragen.
Die drei Siegerprojekte erhalten vom Land jeweils ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro. Die Umsetzung der Projekte erfolgt 2026.
Quelle: NRW.Energy4Climate