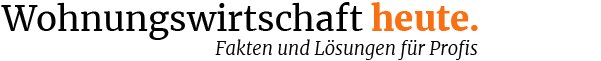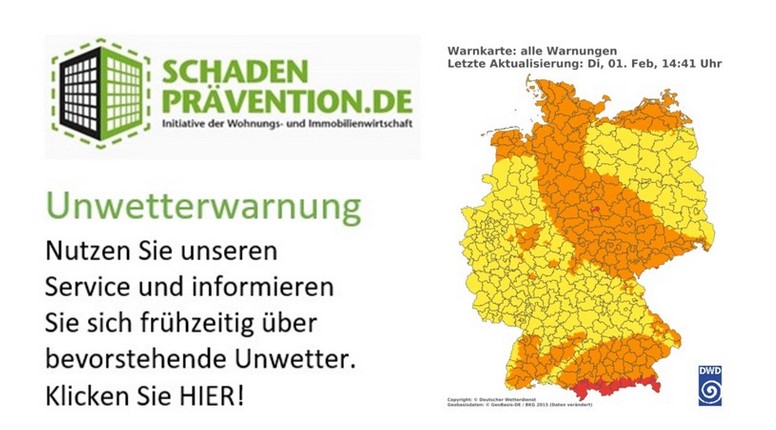Liebe Leserinnen, lieber Leser.
Die Wärmewende ist eine der zentralen Stellschrauben auf dem Weg zur Klimaneutralität. Sie erfordert innovative technische Lösungen, soziale Verantwortung und vor allem politische Verlässlichkeit. Drei Beispiele aus der Praxis zeigen, wie unterschiedlich die Wege sein können – und doch ein gemeinsames Ziel verfolgen: bezahlbaren, klimafreundlichen Wohnraum in der Fläche möglich zu machen.
1. Denkmal in Berlin trifft Datenzentrum: Das Pallasseum als Vorbild für klimafreundliche Sanierung im Bestand
Wenn ein denkmalgeschützter Betonriese aus den 1970er-Jahren zu einem Symbol für Klimaschutz wird, dann darf man zurecht von einem Meilenstein sprechen. Im Berliner Pallasseum gelingt genau das: Die Wohnanlage mit rund 500 Einheiten wird künftig zu 65 % mit der Abwärme eines benachbarten Rechenzentrums beheizt – ohne Eingriffe in die Gebäudehülle und ohne Mieterhöhungen.
Das technische Prinzip ist ebenso einfach wie bestechend: Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe hebt die Abwärme des Rechenzentrums auf 70 bis 75 °C an – ausreichend für eine klassische Heizungsanlage. Über eine Nahwärmetrasse gelangt die Wärme direkt ins Quartier. Nur in Spitzenzeiten springt ein Gaskessel ein.
Was dieses Projekt so besonders macht:
Denkmalgerecht: Keine Fassadendämmung notwendig. // Sozialverträglich: Keine Belastung für die Mieterschaft. // Kooperativ: Öffentliche Wohnungswirtschaft, Telekom und Energieversorger ziehen an einem Strang.
Markus Terboven von der Gewobag bringt es auf den Punkt: „Dieses Projekt beweist eindrucksvoll, dass Denkmalschutz, soziale Verantwortung und Klimaziele vereinbar sind.“
2. Standardisierung ist der Schlüssel: Wärmepumpen im Mehrfamilienbestand
Während Wärmepumpen im Neubau bereits Standard sind, bleibt ihr Einsatz im Bestandsbau – insbesondere im verdichteten Mehrfamilienhaussegment – eine Herausforderung. Das Land Nordrhein-Westfalen geht hier proaktiv voran und hat mit der „WärmepumpenChallenge.MFH“ zukunftsweisende Konzepte ausgezeichnet.
Die Erkenntnis:
Standardisierbare, skalierbare Lösungen sind möglich – auch bei begrenztem Platz, hohen Vorlauftemperaturen oder dezentralen Bestandsanlagen. Die ausgezeichneten Konzepte aus Köln, Düsseldorf und Werdohl liefern praxisnahe Antworten auf diese Komplexität.
Dr. Katharina Schubert (NRW.Energy4Climate): „Wir wollen der Wärmewende in Mehrfamilienhäusern einen Schub geben. Mit den Gewinnerkonzepten zeigen wir, wie Wärmepumpen auch unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren können.“
Die vorgestellten Lösungen stehen für mehr als nur technische Machbarkeit. Sie zeigen, wie durch clevere Planung und Kooperation serielle Lösungen entstehen können, die das enorme Potenzial des Bestandsbaus endlich heben – und somit der Wärmewende in Deutschlands größten Wohnungsmärkten den nötigen Schwung geben.
Appell: Politische Planbarkeit statt Verschiebungen – Vertrauen in den rechtlichen Rahmen schaffen
Doch all die guten Ideen und technischen Lösungen benötigen einen verlässlichen politischen Rahmen. Der Vorschlag der Ministerpräsidentenkonferenz, die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) um zwei Jahre zu verschieben, ist daher ein fatales Signal.
Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) warnt zu Recht: „Verbraucher und Branche haben einen Anspruch auf einen rechtssicheren und stabilen Handlungsrahmen“, so BWP-Geschäftsführer Dr. Martin Sabel.
Zweifel an der EPBD zu säen, gefährdet Investitionen, verzögert dringend notwendige Transformationen und untergräbt die Glaubwürdigkeit der Politik in puncto Klimaschutz. Wer in Wärmepumpenlösungen oder innovative Energieinfrastruktur investiert, braucht Planungssicherheit. Ein Rückzieher auf europäischer Ebene wäre nicht nur symbolisch problematisch – er würde auch praktisch bremsen, was bereits heute funktioniert.
3 Themenwechsel: Architektur mit Weitblick – Kindgerechtes Wohnen als Entwurfsaufgabe
Im Rahmen des renommierten Alvar-Aalto-Preis Bremen stand in diesem Jahr das Thema „Kinderräume im urbanen Wohnumfeld“ im Fokus. Unter dem Titel „Wohnen statt Parken“ suchte die GEWOBA gemeinsam mit der Hochschule Bremen nach kreativen Ideen für die Umgestaltung eines ehemaligen Parkplatzes in Bremen Horn-Lehe – hin zu einem kindgerechten Wohnort.
Aus 40 Einreichungen überzeugte ein Entwurf besonders: Architekturstudentin Ekatarina Ponamorevan gewinnt mit ihrem Beitrag „Weitblick durch den Alltag“ die Jury.
Was ihren Entwurf auszeichnet:
Transformation eines Parkplatzes in lebendigen, kindgerechten Stadtraum. // Durchdachte Grundrisse, nachhaltige Materialien, intelligente Erschließung. // Fokus auf Rückzugsorte und Bewegungsräume für Kinder. // Integration in den städtebaulichen Kontext mit hoher Aufenthaltsqualität.
Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris Reuther lobt: „Eine herausragende Arbeit […], die vor allem mit dem Erschließungssystem das Thema ‚Die Räume der Kinder‘ in den Fokus rückt.“
Mit diesem Entwurf zeigt sich: Stadtentwicklung mit dem Blick aufs Kind ist nicht nur sozialpolitisch geboten, sondern auch architektonisch und städtebaulich eine Bereicherung. Die Arbeit von Ekatarina Ponamorevan steht exemplarisch für eine neue Generation von Architektinnen und Architekten, die den Wandel der Städte mitgestalten – inklusiv, nachhaltig und zukunftsorientiert.
Die Wärmewende gelingt, wenn wir gute Ideen nicht ausbremsen, sondern skalieren. Wenn Politik Verlässlichkeit schafft. Und wenn der soziale wie der architektonische Blick auf den Menschen im Mittelpunkt bleibt – von der Großlösung im Bestand bis zum kindgerechten Wohnquartier. Die jeweilige Langfassung finden Sie in dieser Ausgabe.
Dezember 2025, Wohnungswirtschaft heute., Ausgabe Nummer 207, mit neuen Inhalten.
Klicken Sie mal rein.
Bleiben Sie zuversichtlich und nachhaltig.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.
Ihr Gerd Warda und das Wohnungswirtschaft heute-Team