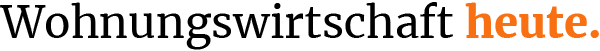Maßstab für eine soziale Wohnbaupolitik sollten Bedürfnisse, nicht die marktbestimmte Nachfrage sein. Was das konkret bedeutet, untersuchte die Architektin Gabu Heindl in einer Studie unter dem Titel „Working Women Wohnen“ im Auftrag der Wiener Wohnbauforschung.
ROBERT TEMEL
Wenn man beispielsweise den Wiener Wohnbaumarkt betrachtet, dann kann man den Eindruck gewinnen, gebraucht werden eigentlich nur Zwei- bis Drei-Zimmer- Wohnungen zwischen 40 und 70 Quadratmeter. Das wird hauptsächlich produziert, das wird hauptsächlich nachgefragt, alles andere firmiert unter „ferner liefen …“. Das bedeutet jedoch nicht, dass genau diese Wohnungen gebraucht werden.
Sondern diese Dimension ist die Schnittmenge zwischen dem, was sich viele gerade noch leisten können, und dem, was funktional gerade noch ausreicht. Von bedürfnisgerechtem Wohnen kann da oft keine Rede sein. Die Studie hat deshalb eine Gruppe in den Fokus gerückt, die zu den Verlierern des Wohnungsmarkts gehört: alleinstehende, alleinerziehende, arbeitende Frauen.
Frauen verdienen im Schnitt nach wie vor wesentlich weniger als Männer und sind deshalb am Wohnungsmarkt benachteiligt. Es geht in der Studie um alle Frauen, die allein oder zusammen mit ihren Kindern wohnen, und um alle Frauen, die arbeiten, ob nun gegen Lohn oder unbezahlt, und deren Einkommen nicht für die Ausgaben zum Wohnen reicht. Sie stehen damit, so formuliert es die Studie, auch stellvertretend für alle Menschen, die am Wohnungsmarkt aufgrund ihrer geringen finanziellen Ressourcen diskriminiert werden.
Ein Recht auf Wohnen sollte schließlich für jede und jeden gelten. Der Bedarf tritt jedoch nicht in jeder Lebenssituation in gleicher Weise auf, sondern an Lebensumbruchstellen: Wenn die elterliche Wohnung verlassen wird, beim Zuzug in eine Stadt wie Wien, bei Trennung und Scheidung, bei Krankheit, beim Tod eines Partners, beim Pensionsantritt.
Hinsichtlich der Leistbarkeit des Wohnens wird hier nicht von einem Prozentsatz des Einkommens ausgegangen, der noch angemessen wäre, sondern umgekehrt eine Residualberechnung gemacht. Dabei wird gefragt, unter welcher Einkommensschwelle nach Abzug der Wohnkosten die nötigen Alltagsausgaben nicht mehr bezahlt werden können. Eine soziale Wohnungspolitik müsste deshalb im Speziellen diese Bedürfnisse im Blick haben und insbesondere für Frauen einen „room of one’s own“, einen Raum für sich allein zur Verfügung stellen, wie das Virginia Woolf 1929 in ihrem berühmten Essay verlangt hat.
Es soll nicht nötig sein, dass eine Alleinerzieherin in ihrer winzigen B-Wohnung kein eigenes Zimmer hat, sondern am Wohnzimmersofa schläft. Deshalb geht es der Studie auch darum, die „kreativen Lösungen“ der Architektur zu hinterfragen, die bereits in der klassischen Moderne unter dem Schlagwort „Wohnen für das Existenzminimum“ eine wichtige Rolle spielten. Armut lässt sich nicht dadurch beseitigen, dass man in die zu kleine Wohnung eine „coole“ Schlafnische einbaut, das heißt, Architektur allein ist nicht die Lösung, aber sie kann manches beitragen.
Einen Raum für sich allein
Verbesserungsansätze im bestehenden Rahmen der Wohnbauförderung und des Wiener Wohnbaumarkts beschreibt die Studie, beispielsweise das Potenzial des ausfinanzierten Bestands von geförderten Wohnungen im gemeinnützigen Eigentum, das billigste Angebot am Markt – aber gerade nicht an soziale Vergabekriterien gebunden. Ein architektonischer Ansatz wäre es, die Raumpotenziale für niedrigste Einkommen nutzbar zu machen, die seit einigen Jahren von gemeinschaftlichen Wohnprojekten umgesetzt werden – allerdings meist zu Kosten, die eher am oberen Rand des Spektrums des geförderten Wohnbaus angesiedelt sind. Und schließlich wird vorgeschlagen, die seit einigen Jahren üblichen Formen der „Bonuskubaturen“ im Bebauungsplan für die Verbilligung von Wohnungen anzuwenden, ob nun in der Fläche oder in der Höhe.
Und es wird vorgeschlagen, auch über den aktuellen Rahmen des Wohnbaus hinauszudenken: Muss sich Wohnen für sehr niedrige Einkommen selbst refinanzieren? Wird bei den aktuell gewidmeten Dichten und Gebäudetiefen genug Bedacht genommen auf die Qualität von kleinen Wohnungen, etwa hinsichtlich Querlüftung und Belichtung? Nach einer Analyse der gegenwärtigen Rahmenbedingungen des Wohnens für „Working Women“ wird in der Studie eine Reihe von beispielhaften Projekten aus der ferneren und näheren Vergangenheit analysiert, vom Einküchenhaus (eine Großküche für alle ersetzte die Küchen in den Wohnungen) bis zur Frauenwerkstatt, vom Frauenwohnprojekt bis zum Intersektionalen Stadthaus.
Wohnen bei Existenzminimum
Aufbauend darauf wird schließlich ein prototypisches Raumprogramm für ein Wohnhaus entwickelt, das nicht nur bezahlbar ist, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Dabei wird auch versucht, „luxuriöse“ Aspekte von geförderten Wohnbauprojekten, von Harry Glücks Schwimmbad am Dach bis zu den großzügigen, selbstverwalteten Gemeinschaftsräumen der Baugruppen, für jene verfügbar zu machen, denen Derartiges sonst aufgrund von geringem Einkommen…