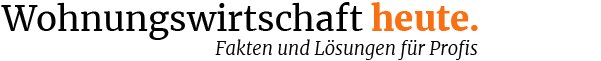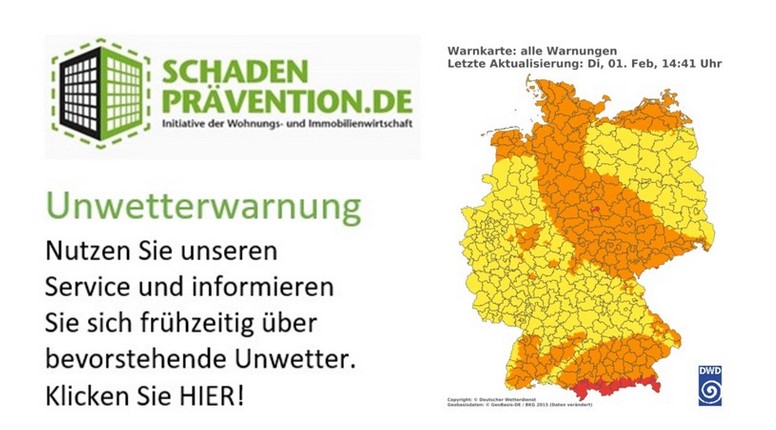Von Ingo Strugalla, Geschäftsführender Vorstand Stiftung Schönau
Die Stiftung Schönau aus Heidelberg steht 2026 vor wichtigen strukturellen Entscheidungen. Steigende finanzielle Verpflichtungen, veränderte Rahmenbedingungen und erhebliche Investitionsbedarfe für den Bestand machen einen stärkeren Eingriff in die Portfoliostruktur notwendig. Gleichzeitig muss die Organisation ihre Prozesse weiter verschlanken.
Für die Stiftung Schönau, ein Immobilienunternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden, wird 2026 zu einem Jahr grundlegender struktureller und wirtschaftlicher Weichenstellungen. Hintergrund ist eine zukünftige deutliche Steigerung der finanziellen Verpflichtungen aus dem Stiftungszweck. Diese Entwicklung zwingt uns dazu, das bestehende Portfolio ertragsstärkend zu restrukturieren sowie neue Ertragsquellen zu erschließen. Der Fokus liegt darauf, die Leistungsfähigkeit der Stiftung langfristig zu sichern und zugleich die Anforderungen einer modernen, langfristig ausgerichteten Vermögensbewirtschaftung zu erfüllen.
Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung unseres Wohnungsportfolios. Ziel ist eine systematische Optimierung des Bestandes durch Neubauten, gezielte Zukäufe oder auch Desinvestitionen dort, wo wirtschaftliche oder strukturelle Aspekte dies nahelegen. Gleichzeitig rückt die Dekarbonisierung stärker in den Vordergrund. Die erforderlichen Investitionen sind erheblich und zählen zu den größten finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre. Dennoch sind sie notwendig, um regulatorische Vorgaben einzuhalten und den Bestand zukunftsfähig zu machen.
Auch die Erbbaurechte gewinnen 2026 an Bedeutung. Viele Verträge nähern sich mittelfristig ihrem Laufzeitende. Frühzeitige Vertragsverlängerungen, gezielte Entschädigungsregelungen zur Entwicklung einzelner Flächen sowie Verkäufe zur Portfoliobereinigung sollen Risiken minimieren und zugleich Ertragschancen erschließen. Im Mittelpunkt stehen stabile Cashflows und die Reduzierung zukünftiger Entschädigungsrisiken.
Parallel baut die Stiftung den Bereich erneuerbare Energien weiter aus. Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeicher bieten – insbesondere in Verbindung mit land- und forstwirtschaftlichen Flächen – zusätzliche, vergleichsweise stabile Ertragsmöglichkeiten und ergänzen das bestehende Portfolio sinnvoll.
Neben diesen fachlichen Themen wird 2026 auch organisatorisch ein prägendes Jahr. Die Stiftung richtet interne Prozesse noch konsequenter auf Effizienz, Transparenz und unternehmerisches Denken aus. Ziel ist eine Kultur, die stärker auf proaktives Handeln, teamorientierte Zusammenarbeit und wirtschaftliche Zielorientierung setzt.
Worauf lässt sich 2026 aufbauen?
Auf die Bereitschaft zur Veränderung und auf die Erkenntnis, dass nur ein aktives, strategisches Management den langfristigen Erfolg sichern kann. Die Chance besteht darin, das Portfolio robuster aufzustellen, neue wirtschaftliche Perspektiven zu erschließen und zugleich gesellschaftlichen Erwartungen an verantwortungsvolle Bewirtschaftung gerecht zu werden.
Was erhoffen wir uns?
Einen höheren operativen Cashflow sowie eine Organisation, die Veränderung als Daueraufgabe akzeptiert und gestaltet.
Was fürchten wir?
Steigende finanzielle Risiken aus Dekarbonisierung, auslaufenden Erbbaurechten und wachsenden Anforderungen aus dem Stiftungszweck. Insbesondere ein Nachlassen der Veränderungsbereitschaft würde notwendige Maßnahmen verzögern und wirtschaftliche Chancen begrenzen.
Insgesamt steht die Stiftung nicht nur vor einem herausfordernden, sondern spannenden Jahr 2026. Ihr Fokus liegt auf der strategischen Absicherung der Erträge weit über das Jahr 2026 hinaus.
Ingo Strugalla
Die Stiftung Schönau ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Heidelberg. Aus rund 21.000 Erbbau- und Pachtverträgen, der Vermietung von rund 900 Wohnungen, Investitionen in Immobilienfonds sowie der Bewirtschaftung von 7.600 Hektar Wald erzielt sie Erlöse, um ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Seit einigen Jahren verpachtet die Stiftung zudem Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.
Aufgabe der Stiftung ist die professionelle Bewirtschaftung ihres Vermögens. Die Erträge daraus fließen zu einem überwiegenden Teil direkt in den Haushalt der Evangelischen Landeskirche in Baden und finanzieren kirchliches Bauen und Pfarrstellen.
Das Stiftungsvermögen stammt aus dem ehemaligen Kloster Schönau (Odenwald). Seit ihrer Gründung im Jahr 1560 verfolgt die Stiftung die Maxime, ihr Handeln auf Dauer anzulegen und langfristig und verantwortungsvoll zu wirtschaften. Mit rund 90 Beschäftigten ist die Stiftung Schönau eine der ältesten Institutionen Heidelbergs.