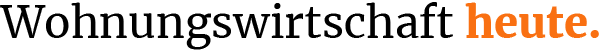Wohnstraße, Schule oder gleich Quartiersentwicklung: Bauträger leisten immer öfter einen Beitrag zur Infrastruktur. Juristisch wird hier oftmals Neuland betreten, doch Koppelungen von Wohnbau und Infrastruktur sind in Österreich gang und gebe – nicht selten mit Erfolg für beide Seiten.
MAIK NOVOTNY
Als Wien mit der Bauordnungsnovelle 2014 erstmals städtebauliche Verträge zwischen Gemeinde und Privaten ermöglichte, reichten die Reaktionen von „Endlich!“ bis zu bedenklichem Stirnrunzeln. Endlich – weil alle anderen Bundesländer bereits ähnliche Regeln vorsehen, von Deutschland und der Schweiz ganz zu schweigen. Auch dass in Zeiten knapper Kassen und knappen Baulands private Widmungsgewinne in Form von Infrastruktur wieder der Allgemeinheit zugutekommen, ist an sich zu begrüßen. Das Denken in städtischem Maßstab, über das Baufeld hinaus, kommt zudem der Quartiersentwicklung zugute. Stirnrunzeln, weil vielen der „Ablasshandel“ nicht ganz geheuer war und ist.
Deutliche Kritik an städtebaulichen Verträgen kam von Architektenseite. Städtische Beamte seien möglicherweise juristisch überfordert, wenn Investoren bei Vertragsverhandlungen mit ihren gewieften Anwälten anrücken, befürchteten Vertreter der Architektenkammer. Noch dazu seien diese Verträge wenig transparent, die gesetzlich vorgeschriebene Gleichbehandlung fraglich. Privatwirtschaftliche Geheimhaltung und demokratische Offenlegung sei schwer vereinbar. Eine Stadtplanung, die sich auf projektweise verhandelte Einzelverträge verlässt, verliere nicht nur die Planungskompetenz, sondern auch das große Ganze aus dem Blick.
Nicht wenige gemeinnützige Bauträger sehen die Verträge ebenfalls skeptisch, weil sie zusätzlichen Planung- und Kostenaufwand befürchten. Fraglich ist auch, wie kompatibel diese Verträge mit dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und dem Kostendeckungsgrundsatz sind. Der Verein für Wohnbauförderung (vwbf) stellte 2017 in seinem Bauland-Mobilisierungspaket die Forderung, „kostenverursachende städtebauliche Verträge als Widmungsvoraussetzungen zurückzunehmen“.
Andererseits führen die städtebaulichen Verträge zu einem Mehr an gefördertem Wohnbau, wenn sie einem Projekt einen gewissen Anteil leistbaren Wohnens vorschreiben. Dies ist in Wien bereits erfolgt, mal mit der Spezifizierung „nach den Bestimmungen der Wiener Wohnbauinitiative“, mal unter der Bedingung, dass ein gemeinnütziger Bauträger die Wohnungen errichten müssen.
Angewendet wurden städtebauliche Verträge in Wien bisher etwa bei freifinanzierten Großprojekten wie dem Hochhaustrio Triiiple. Wien ist das letzte Bundesland, das solche Verträge ermöglicht, in allen anderen sind unterschiedliche Modelle der Vertragsraumordnung bereits Usus. Grundsätzlich geht es dabei um die Abschöpfung von Wertsteigerung für die Allgemeinheit und die Eindämmung der Bodenspekulation. Auch befristete Baulandwidmung oder Widmungskategorien wie „geförderter Wohnbau“ werden als Instrumente angewendet oder zumindest diskutiert. Im Ausland werden solche Instrumente nicht selten schärfer und transparenter angewendet. In Köln etwa werden bei Umwidmungen zwei Drittel des Wertzuwachses zugunsten der Infrastruktur abgeschöpft, in Basel werden 20 Prozent des Mehrwerts abgeführt und fließen in einen zweckgewidmeten Fonds für die Schaffung oder Aufwertung öffentlicher Grünräume.
Andere Schweizer Kantone führen sogar bis zu 50 Prozent des Mehrwerts ab. In München hat sich seit 1994 das Modell der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) im Bebauungsplanverfahren bewährt. Dabei werden Bauträger entweder direkt an Planungskosten beteiligt, treten unentgeltlich Flächen ab oder beteiligen sich an sozialer Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten. 46.250 Wohnungen konnten so bis 2016 geschaffen werden, davon etwa 12.000 im geförderten Wohnungsbau. 2017 wurde die SoBoN angesichts des verschärften Wohnraummangels angepasst. Eine Übernahme des Münchener oder Basler Modells wird auch in Österreich immer wieder diskutiert, ist aber laut Verfassungsrechtlern nicht übertragbar, weil eine monetäre Gewinnabschöpfung einer versteckten Steuer gleichkäme.
Smarte Kooperation
Städtebauliche Verträge sind im steirischen Raumordnungsgesetz seit 2010 vorgesehen, und auch in Graz greift man seither immer wieder auf dieses Instrument zurück, insbesondere bei den großen Entwicklungsgebieten wie Reininghaus und Smart City. Nachdem der Ankauf der Reininghaus-Gründe durch die Stadt 2012 um 75 Millionen Euro in einer Volksabstimmung mehrheitlich abgelehnt wurde, ist die Kooperation mit Privaten hier ohnehin alternativlos. Allein für die Infrastruktur in Reininghaus hat die Stadt Graz Investitionen von rund 120 Millionen Euro errechnet, für deren Errichtung die Investoren einen Infrastrukturbeitrag von 30 Euro pro Quadratmeter…