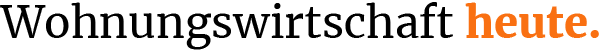Gemeinschaftliches Wohnen gewinnt in Europa wieder an Interesse. Wien spielt eine internationale Vorreiterrolle, wo Baugemeinschaften zu einem zentralen Bestandteil von Stadtentwicklungsstrategien geworden sind.
RICHARD LANG
ei den gemeinschaftlichen Wohnmodellen geht es um den Aufbau enger nachbarschaftlicher Kontakte im Alltag sowie mehr Mitbestimmung in Planung und Nutzung des Wohnprojekts. Eine aktuelle Studie zeigt die Chancen und Potenziale für gemeinnützige Bauträger auf. Dabei kristallisieren sich drei idealtypische Modelle zur Realisierung eines gemeinschaftlichen Wohnbauprojektes heraus.
Beim „Bottom-Up-Modell“ steuert eine Bewohnergruppe, oft unterstützt durch Architekten, die Planung und Realisierung des gemeinschaftlichen Wohnprojekts weitgehend selbst. Die Tradition dieses Modells geht bis in die 1970er Jahre zurück. Außerhalb von Wien werden selbstorganisierte Gemeinschaftsprojekte meist im Wohnungseigentum realisiert. Aber auch in der Hauptstadt finden sich aktuelle Eigentumsprojekte, wie „Grätzelmixer“ am Hauptbahnhof und „Seeparq“ in der Seestadt Aspern. Die Bewohner bilden eine solidarische Wertegemeinschaft, die sich bewusst nicht gegenüber der unmittelbaren Nachbarschaft abgrenzen möchte. Zudem ist ihnen volle Selbstverwaltung ein wichtiges Anliegen. Jedoch stellen Bottom-Up-Projekte durch hohe zeitliche Ressourcen und finanzielles Risiko überdurchschnittlich hohe Anforderungen an alle Beteiligten.
Diese Erkenntnis hat zur Gründung erster Trägerverbände für selbstorganisierte Wohnprojekte geführt wie die „Wohnprojekte-Genossenschaft (Die WoGen)“ oder den stärker ideologisch ausgerichteten „Dachverband habiTAT”, welcher durch Crowdlending – Kredit von Privat an Privat – lokale Projektgruppen unterstützt. Die schwierige Anfangsphase in selbstorganisierten Wohnprojekten führt weiters dazu, dass Gruppen sich den etablierten gemeinnützigen Bauträgern zuwenden, um das finanzielle Risiko zu minimieren und den Ablauf des Gesamtprojekts zu professionalisieren.
Das Partnerschaftsmodell
Bei diesem Modell plant und realisiert eine Gruppe, oft als Bewohnerverein organisiert, das gemeinschaftliche Wohnprojekt gemeinsam mit einem gemeinnützigen Bauträger. Dieser finanziert die Baukosten, bleibt meist Eigentümer des Wohnobjekts und vermietet es mit Kaufoption an die Bewohner. Wie beim Baugruppen-Projekt „Pegasus” in der Seestadt Aspern ermöglicht die Zusammenarbeit mit dem Bauträger den Zugang zum Grundstück und Wohnbaufördermitteln, was sich positiv auf die Leistbarkeit und soziale Durchmischung des Projekts auswirkt. Die Gemeinde Wien hat durch den Fokus auf soziale Nachhaltigkeit in Bauträgerwettbewerben Anreize für Gemeinnützige geschaffen, sich im Markt des gemeinschaftlichen Wohnens zu engagieren. Andererseits nimmt die Gemeinde als Fördergeber Einfluss auf die Zusammensetzung der Bewohnerschaft.
Dies kann zu Problemen führen, wenn bereits eine kohäsive Bewohnergruppe besteht, die durch gleiche Werte verbunden ist. Wie die Cohousing-Projekte „Pomali“ und „Lebensraum“ in Niederösterreich zeigen, kommt es beim Partnerschaftsmodell auf eine tragfähige persönliche Beziehung zwischen dem Bauträger und der Bewohnergruppe an. Letztere agiert bei der Auswahl von Nachmietern weitgehend autonom, damit das Gemeinschaftsprojekt sein Potential entfalten kann. Wesentliche Verwaltungsaufgaben können von den Bewohnern selbst organisiert werden, die sich stark mit ihrem Wohnprojekt identifizieren. Daher ist ihnen ein guter Erhaltungszustand wichtig und der Bauträger hat verlässliche Mieter. Ein Wiederverwertungsrisiko für Wohnungen in Gemeinschaftsprojekten konnte bisher empirisch nicht belegt werden. Ganz im Gegenteil gibt es bei den bisher untersuchten Projekten in Österreich meist längere Wartelisten.
Wohnen als Komplettangebot
Bei diesen Top-down-Projekten des gemeinschaftlichen Wohnens wird das Projekt vom gemeinnützigen Bauträger in Zusammenarbeit mit Experten für dieses Marktsegment konzipiert und realisiert. Es bietet Bewohnern, die nach Gemeinschaft und verlässlicher Nachbarschaft suchen, ein Mehr an frühzeitigen Möglichkeiten zur Partizipation in einem vorgegebenen Rahmen als dies üblicherweise von Bauträgern im sozialen Wohnbau angeboten wird. Aktuelle Beispiele sind das Projekt „so.vie.so“ beim Hauptbahnhof in Wien oder das Generationenwohnen in der „Rosa Zukunft“ in der Stadt Salzburg. Beide Projekte sind in Programme zur Quartiersentwicklung eingebettet und haben jeweils über 100 Wohneinheiten, sowie unterschiedliche Gemeinschaftsräume.
Chancen für die Zukunft
Bei diesen Top-down-Projekten kommt es umso mehr auf das Know-how von externen Dienstleistern für Moderation und Schnittstellenkommunikation an, die zu einer ökonomischen Abwicklung beitragen können. Ziel der Begleitung ist, dass die Bewohner eine gewisse Eigenverantwortung übernehmen und so auch Probleme selbst lösen.
Mit gemeinschaftlichen Wohnmodellen können vielfältige Aspekte des Sozialen im Wohnbau stärker betont werden – von der funktionierenden Nachbarschaft bis hin zu integrativen Leistungen für ältere Menschen und sozial Benachteiligte. Die Bewohner öffnen Gemeinschaftsflächen für Externe und so entsteht neue soziale Infrastruktur im Ort oder Grätzel…