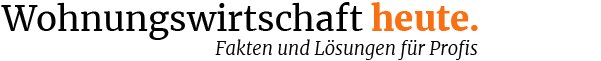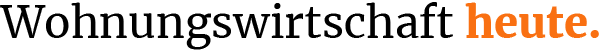Einordnung von Orla Nolan, Blackprint, zur Startup-Session auf der HEIKOM 2025
Gleich zu Beginn der Startup-Session ordnet Orla Nolan vom Innovationshub Blackprint die Rolle von PropTech für die Bau- und Immobilienbranche ein. Blackprint versteht sich als Netzwerk-Knoten für innovative Lösungen im Gebäudesektor – mit dem Anspruch, PropTech-Unternehmen sichtbar zu machen und mehr Transparenz rund um neue Technologien zu schaffen. Gemeinsam mit Deumess kuratiert Blackprint die Startup-Area und die inhaltliche Session auf der HEIKOM 2025.
Nolan macht deutlich, warum PropTech aus ihrer Sicht gerade jetzt so entscheidend ist: Der Gebäudesektor steht vor einer massiven Transformation. Steigende Energiekosten, ambitionierte Klimaziele, Fachkräftemangel und neue regulatorische Anforderungen treffen auf einen Bestand, der in großen Teilen „analog, heterogen und ineffizient“ sei. Gebäude sind für einen erheblichen Anteil des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland verantwortlich, ein Großteil entfällt auf Heizung, Warmwasser und Lüftung. Allein in der Bewirtschaftung liegen Effizienzpotenziale von rund 20 bis 40 Prozent, die sich durch Digitalisierung, Monitoring und automatische Steuerung heben lassen – also mit Lösungen, die technisch längst verfügbar sind.
Vor diesem Hintergrund, so Nolans Kernbotschaft, ist technologische Innovation kein „Nice-to-have“-Add-on mehr, sondern ein Schlüssel zum Erfolg. PropTech-Lösungen sollen helfen, den bestehenden Gebäudebestand intelligenter zu betreiben, Verbräuche transparent zu machen und Effizienzpotenziale systematisch zu nutzen – trotz knapper personeller Ressourcen.
Die anschließende Startup-Session versteht Nolan daher als Blick in die unmittelbare Praxis: Welche PropTechs es bereits gibt, welche konkreten Lösungen sie anbieten und wie diese den genannten Herausforderungen begegnen, zeigen die folgenden Pitches. Den Auftakt macht Michael Spahn mit einer Lösung, die Heizsysteme transparent, effizient und digital steuern soll – ein Beispiel dafür, wie sich die abstrakte Debatte über Effizienz unmittelbar im Heizungskeller niederschlägt.
Glossar
- PropTech
Kurz für Property Technology. Gemeint sind Startups und Technologieunternehmen, die digitale Lösungen für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft entwickeln – etwa für Energieeffizienz, Bewirtschaftung, Vermietung, Serviceprozesse oder Finanzierung. - Monitoring (von Gebäuden/Anlagen)
Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Messdaten aus Gebäuden, z. B. Temperaturen, Verbräuche, Laufzeiten oder Störmeldungen. Monitoring ist die Grundlage, um Auffälligkeiten zu erkennen und Optimierungen gezielt vorzunehmen. - Automatische Steuerung
Regelung von Anlagentechnik (z. B. Heizung, Lüftung, Pumpen) durch Software oder Algorithmen statt durch manuelle Eingriffe. Die Systeme reagieren eigenständig auf Messwerte, Zeitprogramme oder externe Signale (z. B. Wetterdaten). - Bewirtschaftung / Betrieb von Gebäuden
Umfasst alle laufenden Aufgaben rund um ein Gebäude: technischer Betrieb, Instandhaltung, Energieversorgung, Service für Mieter:innen sowie kaufmännische Prozesse. Effizienzpotenziale entstehen hier vor allem durch bessere Daten und automatisierte Abläufe. - Digitalisierung im Gebäudesektor
Einsatz digitaler Technologien wie Sensorik, IoT-Plattformen, Cloud-Software oder KI, um Gebäude transparenter, besser steuerbar und energieeffizienter zu machen – insbesondere im Bestand.
________________________________________
Autor: Redaktion Wohnungswirtschaft Heute – HEIKOM-Sonderausgabe Startups 2025
Foto: DEUMESS – Frank Schütze / Fotografie Kranert