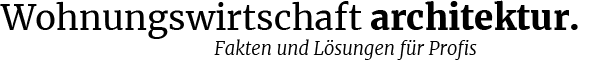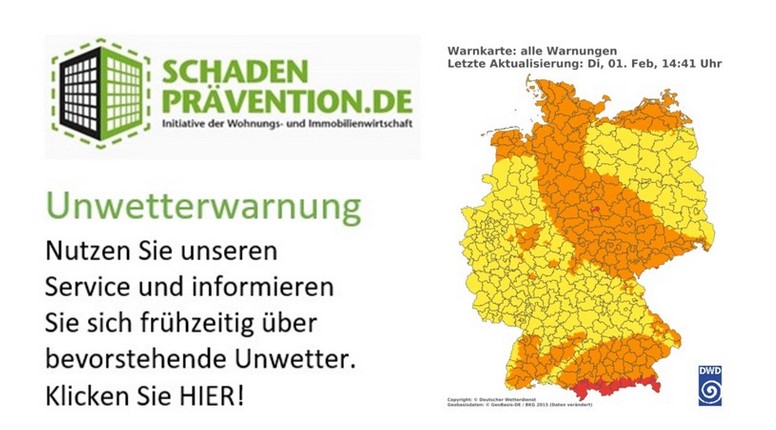Das Architekturbüro Sauerbruch Hutton aus Berlin erhält zum zweiten Mal den mit 30.000 Euro dotierten Deutschen Architekturpreis. Es realisierte zusammen mit der Innovatio Projektentwicklung aus Heidelberg und Profund aus Gera das „Franklin Village“ in Mannheim.
Der Staatspreis wird alle zwei Jahre für herausragende baukulturelle Leistungen durch das Bundesbauministerium und die Bundesarchitektenkammer vergeben und ist die bedeutendste Auszeichnung für Architektinnen und Architekten in Deutschland. Das Verfahren führt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) durch. Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger und die feierliche Preisverleihung fand am 18. September 2025 in Berlin statt.
Ein Zuhause ist, wo wir uns wohlfühlen
Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), Verena Hubertz hebt die Vorbildfunktion des Projektes hervor: „Ein Zuhause ist, wo wir uns wohlfühlen. Dieses Gefühl endet nicht an der Wohnungstür, sondern bezieht das ganze Quartier mit ein. Im ‚Frankling Village‘ wird dieser Gedanke gelebt.
Das Ensemble ist fast komplett in Holzbauweise errichtet, leistet seinen Anteil bei der Minimierung von CO2-Emmissionen und ist nachhaltig. Gutes Wohngefühl der Bewohnerinnen und Bewohner ist quasi mit verbaut. Als Preisträger strahlt das Projekt nach außen und zeigt, wie unsere Architektur der Zukunft aussehen kann: Inklusiv, bezahlbar und ökologisch.“
Bezahlbares Bauen und Baukultur muss kein Widerspruch sein
Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer (BAK): „Jede Bauaufgabe gestaltet Zukunft. Angesichts der Wohnungsbaukrise brauchen wir Lösungen, die nicht nur schnell und günstig, sondern auch ökologisch verantwortlich, sozial verträglich und architektonisch hochwertig sind. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Architekturpreises zeigen eindrucksvoll, dass bezahlbares Bauen und Baukultur kein Widerspruch sein müssen – sondern durch intelligente Konzepte und mutige Planung Hand in Hand gehen können.“
Mit dem Projekt Franklin Village ist es Sauerbruch Hutton gelungen, ein herausragendes architektonisches wie soziales Leuchtturmprojekt im urbanen Raum zu realisieren. Die Wohnbebauung ist das Herzstück eines neuen Quartiers, das beispielhaft für gelungene Nachverdichtung, durchmischtes Wohnen und exzellente Gestaltung steht.
In einem ehemaligen Militärareal ist ein lebendiges Mehrgenerationenquartier entstanden, das Vielfalt nicht nur verspricht, sondern lebt. Fünf Neubauten und ein sensibel erweitertes Bestandsgebäude fügen sich zu einem Ensemble, das unterschiedlichste Lebensformen integriert: vom Single-Apartment über klassische Familienwohnungen bis zu Clusterwohnungen mit gemeinschaftlicher Nutzung.
Um einen geschützten, mit Bäumen begrünten Innenhof gruppiert, ermöglichen stützenfrei vorgelagerte Laubengänge spontane Begegnungen und fördern nachbarschaftlichen Austausch. Die farbigen Trennwände und Deckenunterseiten der Laubengänge stehen im Kontrast zur grau lasierten Holzfassade und geben dem Hof eine unverwechselbare und heitere Atmosphäre. Mit den großzügigen Freitreppen in den Innenhof entsteht ein Wegekontinuum, das den perfekten räumlichen Rahmen für gelebte Gemeinschaft bildet. Architektonisch überzeugt Franklin
illage durch eine klare, unaufgeregte Sprache und kompromisslose Qualität im Holzbau. Die räumlichen Lösungen zeigen eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit und Gestaltung Hand in Hand gehen können.
Das Ensemble wird nicht nur von seiner Bewohnerschaft genutzt, sondern lädt auch Passanten mit Plätzen unterschiedlicher Qualität zum Verweilen ein. Franklin Village ist mehr als ein Wohnbauprojekt – es ist ein Statement für eine zukunftsfähige Stadtgesellschaft: vielfältig, nachhaltig, schön.
Neben dem Deutschen Architekturpreis vergab die Jury zehn Auszeichnungen mit jeweils 3.000 Euro Preisgeld.
Die große Bandbreite der 192 zugelassenen Einreichungen von 176 Büros und Arbeitsgemeinschaften hat die Jury beeindruckt.
Der Deutsche Architekturpreis reicht bis in das Jahr 1977 zurück und wird seit 2011 vom BMWSB und der BAK gemeinsam ausgelobt und als Staatspreis für Architektur verliehen. Seitdem ist das BBR verantwortlich für das Verfahren und koordiniert den Wettbewerb.
Mit dem Deutschen Architekturpreis werden für die Entwicklung des Bauens beispielhafte Bauwerke ausgezeichnet, die eine herausragende architektonische und baukulturelle Qualität aufweisen und im Neubau oder bei der Sanierung und Modernisierung historischer Bausubstanz von einem vorbildlichen Umgang mit Konstruktion und Material zeugen. Sie sind dem nachhaltigen Bauen in ökologischer, ökonomischer und soziokultureller Hinsicht verpflichtet und tragen positiv zur Gestaltung des öffentlichen Raumes bei.
Von den ausgezeichneten Bauwerken sollen zum einen Anregungen für zukünftige Planungen ausgehen, zum anderen sollen sie die Bedeutung der Baukultur und des nachhaltigen Bauens der Öffentlichkeit näherbringen.
Der Jury des Architekturpreises gehörten an:
Andrea Gebhard, Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, Präsidentin der BAK // Dirk Scheinemann, Abteilungsleiter Baupolitik, Bauwirtschaft, Bundesbau, BMWSB // Prof. Stephan Birk, Architekt, Stuttgart / München // Gustav Düsing, Architekt, Berlin // Prof. Donatella Fioretti, Architektin, Berlin / Düsseldorf // Martin Haas, Architekt, Stuttgart // Prof. Michelle Howard, Architektin, Berlin / Wien
Stellvertretende Preisrichterinnen:
Petra Wesseler, Präsidentin des BBR // Andrijana Ivanda, Architektin, Berlin
Ergebnisse der Jurysitzungen vom 6. Mai und 19. Juni 2025:
Deutscher Architekturpreis 2025 (30.000 Euro):
Projekt: Franklin Village, Mannheim // Verfasser: Sauerbruch Hutton, Berlin // Bauherr: Innovatio Projektentwicklung GmbH, Heidelberg / Profund GmbH, Gera


Auszeichnung (3.000 Euro):
Projekt: Unser Gartenhaus – Haus ohne Zement // Verfasser: Florian Nagler Architekten, München // Bauherr: Florian Nagler, München


Mit großer Selbstverständlichkeit fügt sich das Gartenhaus in die kleinteilige, gewachsene Struktur des rückwärtigen Grundstücks in München-Pasing ein. Die Setzung des Baukörpers hinter dem Bestandsgebäude ist sowohl räumlich als auch atmosphärisch überzeugend: Der Zwischenraum zwischen Alt- und Neubau ist gut proportioniert, während sich der Gartenbereich hinter dem Gebäude zum angrenzenden Kanal hin öffnet. Die Möglichkeiten des geltenden Baurechts wurden dabei klug ausgeschöpft. Das Projekt steht exemplarisch für die Haltung des „Einfach Bauens“. Es verzichtet bewusst auf komplexe Technik und setzt stattdessen auf passive Prinzipien, robuste Materialien, einfache Aufbauten der Bauteile und eine klare, nachvollziehbare Konstruktion. Entstanden ist ein zurückhaltender, zugleich präzise formulierter Bau, der durch seine handwerkliche Qualität und sorgfältige Materialwahl besticht. Decken und Wände sind in Holz ausgeführt; ergänzt wird die Konstruktion durch Lehm, der als Steinlage zwischen den Balken und als Putz an den Innenwänden Verwendung findet.
Hervorzuheben ist die konsequente Vermeidung mineralischer Baustoffe, es ist ein Haus ohne Zement: Auch die Bodenplatte wurde in Holz ausgeführt, möglich durch die Ausbildung eines Kriechkellers für die Belüftung und den Einsatz von Schraubfundamenten.
Das Gebäude überzeugt durch seine funktionale Organisation. Im Erdgeschoss liegen Eingangsbereich, Büro und Besprechungsraum; im Obergeschoss schließen sich die Arbeitsräume an. Das Dachgeschoss nimmt gemeinschaftlich genutzte Bereiche wie Küche, Stube und eine kleine Wohnung auf – jeweils geprägt von klar gegliederten Raumfolgen. Das Gartenhaus ist ein gelungenes Beispiel für eine ökologisch reflektierte Baupraxis im kleinen Maßstab – leise, präzise und von hoher Gebrauchstauglichkeit im Alltag.“ Fotos: Sebastian Schels


Projekt: Stiftungsensemble: Spore Initiative und Publix, Berlin // Verfasser: AFF Architekten, Berlin // Bauherr: Schöpflin Stiftung, Lörrach


Projekt: Integratives Familienzentrum des Deutschen Kinderschutzbund e. V., Dresden // Verfasser: ALEXANDER POETZSCH ARCHITEKTUREN, Dresden // Bauherr: Deutscher Kinderschutzbund e. V. Ortsverband Dresden


Projekt: Mehrzweckhalle Ingerkingen // Verfasser: Atelier Kaiser Shen, Stuttgart // Bauherr: Gemeinde Schemmerhofen


Projekt: Höllensteinhaus, Viechtach // Verfasser: Bergmeisterwolf, Brixen // Bauherr: Immobilien Projekt Invest, Karlsruhe


Projekt: Aufstockung NORDGRÜN, Karlsruhe // Verfasser: Drescher Michalski Architekten, Karlsruhe // Bauherr: NordGrün, Lukas Hechinger, Karlsruhe


Projekt: Das robuste Haus – Mehrgenerationenhaus Görzer Straße 128, München // Verfasser: etal. ArchitektInnen PartGmbB Bengtsson Masla Syren, München // Bauherr: Görzer128, München


Projekt: Eingangsgebäude LWL-Freilichtmuseum Hagen // Verfasser: Schnoklake Betz Dömer Architekten, Münster // Bauherr: LWL, Münster


Projekt: Wintergartenhaus // Verfasser: Supertype Group, Berlin // Bauherr: Alexandra Flother, Berlin


Projekt: Innovationsfabrik 2.0 Heilbronn // /Verfasser: Waechter + Waechter Architekten, Darmstadt // Bauherr: Stadtsiedlung Heilbronn


Cathrin Urbanek BAK