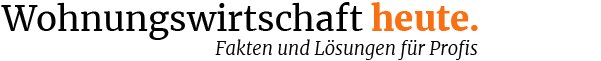Von Magdalena Strasburger
Photovoltaik (PV) auf Wohngebäuden wird nicht nur gefordert, sondern zunehmend erwartet: Gesetzgeber, Mieter und Gesellschafter ziehen hier an einem Strang. Doch viele Projekte scheitern oder stagnieren, bevor das erste Modul montiert ist.
In meiner Arbeit mit Wohnungsunternehmen sehe ich immer wieder die gleichen Stolpersteine, aber auch wiederkehrende Erfolgsrezepte. Werden bestimmte Grundlagen beachtet, lassen sich Energieprojekte realistisch, wirtschaftlich und sozialverträglich umsetzen:
Klare Zieldefinition statt Aktionismus
Ein Projekt kann nur dann erfolgreich sein, wenn klar ist, welchem Zweck es dienen soll. Die Motive reichen von CO₂-Reduktion und langfristiger wirtschaftlicher Unabhängigkeit bis hin zu Imagepflege und ESG-Vorgaben. Doch allzu oft starten Projekte, ohne dass dieses Ziel intern sauber abgestimmt wurde. Dann verzetteln sich die Beteiligten zwischen Förderrecherche, Vertragsentwürfen und Technikfragen, ohne zu wissen, in welche Richtung sie eigentlich arbeiten.
Deshalb gilt es im erste Schritt immer zu definieren was das Projekt leisten soll und was keine so hohe Priorität hat. Wer Rendite erzielen möchte, plant anders als jemand, der PV möglichst unkompliziert auf möglichst vielen Dächern installieren will.
Wirtschaftlichkeit realistisch betrachten
Wirtschaftlichkeit ist ein sensibles Thema. Zu viele Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen basieren auf idealisierten Eigenverbrauchsquoten und optimistischen Installationskosten. Auch wer davon ausgeht, dass Fördermittel sicher fließen, riskiert böse Überraschungen.
Hinzu kommt, dass Themen wie Stromsteuer, Gewerbesteuerrisiko oder die Anforderungen der Marktkommunikation oft unterschätzt werden. Insbesondere die Einbindung von Messstellenbetreibern und Netzbetreibern kann organisatorisch und finanziell zur Herausforderung werden. Der Aufwand entsteht nicht erst beim Betrieb, sondern bereits in der Konzeptionsphase. Deshalb lohnt sich ein nüchterner Blick auf den Business Case!
Technische Machbarkeit prüfen
Leider ist nicht jedes Dach für Solar geeignet. Das klingt banal, wird in der Praxis aber oft verdrängt. Ob Statik, Verschattung, Elektroinstallation oder Zählerstandort, all diese Faktoren entscheiden über die Machbarkeit und die Kosten. Projekte, die ohne eine gründliche technische Vorprüfung starten, erleben häufig Rückschläge, weil beispielsweise Kabelwege nicht vorgesehen wurden, der Keller feucht ist oder der Wechselrichter keinen Platz findet.
Ein realistischer Gebäudecheck des Bestandes spart Zeit und Geld und schafft intern Vertrauen in das Projekt. Wer dagegen zu schnell in die Umsetzung geht, riskiert Frustration.
Kommunikation ist der unterschätzte Erfolgsfaktor
Technik ist wichtig, doch Kommunikation ist entscheidend! Gerade bei Mieterstromprojekten im Bastand zeigt sich: Wenn Mieter nicht frühzeitig eingebunden werden, kann selbst das technisch perfekte Projekt scheitern. Informationsmaterialien, persönliche Ansprechpartner:innen und transparente Zeitpläne helfen dabei, Akzeptanz zu schaffen. Dasselbe gilt intern. Hausmeisterdienste, Verwaltungsmitarbeitende und Projektbeteiligte müssen alle wissen, was wann passiert und warum.
Auch die Kommunikation mit Externen muss stimmen. Wer hier zu spät oder unklar kommuniziert, mit Netzbetreiber, Dienstleistern oder Partnern, riskiert Zeitverzug oder Doppelarbeit. Ein häufiger Fehler ist es, Projekte zu lange intern zu entwickeln und dann mit dem Anspruch „Jetzt muss alles schnell gehen“ an die Umsetzung zu gehen. Erfolgreiche Projekte haben eine klare und regemelmäßige Kommunikation aller Stakeholder.
Mit dem richtigen Partner starten
Gerade kleinere Wohnungsunternehmen müssen Energieprojekte nicht allein stemmen. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern ist sinnvoll!
Dabei kommt der Auswahl des Partners eine entscheidende Rolle zu. Es geht nicht nur um Preis, sondern auch um Haltung, Erfahrung und die Bereitschaft, Wissen zu teilen. Nur so wird aus dem ersten Projekt eine Strategie und aus dieser ein wiederholbares Modell.
Nach der Auswahl des passenden Partners, sollte zunächst mit einem Pilotprojekt gestartet werden. Hier können Erfahrungen gesammelt werden, die dann Schrittweise auf des gesamten Bestand angewendet werden.
Wir haben mit einem strukturierten Fahrplan gute Erfahrungen gesammelt: In der Initiierungsphase werden Bedarfe geklärt, Wissen aufgebaut und erste Strategien entwickelt. In der Planungsphase steht die Machbarkeitsanalyse (was) im Vordergrund, gefolgt von Modellkonzeption (wie) und Partnerwahl (wer/mit wem). Erst dann beginnt die Umsetzungsphase und wird von einem aktivem Stakeholdermanagement begleitet. In der Abschlussphase erfolgen die formelle Übergabe, die Dokumentation und eine Bewertung.
Magdalena Strasburger ist mit ihrem Beratungsunternehmen Strasburgerenergie energie|technologie seit über 10 Jahre in der Welt der Energie unterwegs. Sie baut nachhaltig Brücken zwischen der Immobilien- und Energiewirtschaft. Ihr besonderes Augenmerk liegt auf dem Mieterstrom.
Magdalena Strasburger // Strasburger ET GmbH // office@strasburger-et.de // http://www.strasburger-et.de/