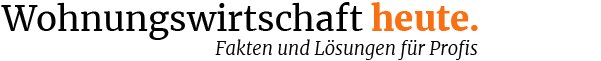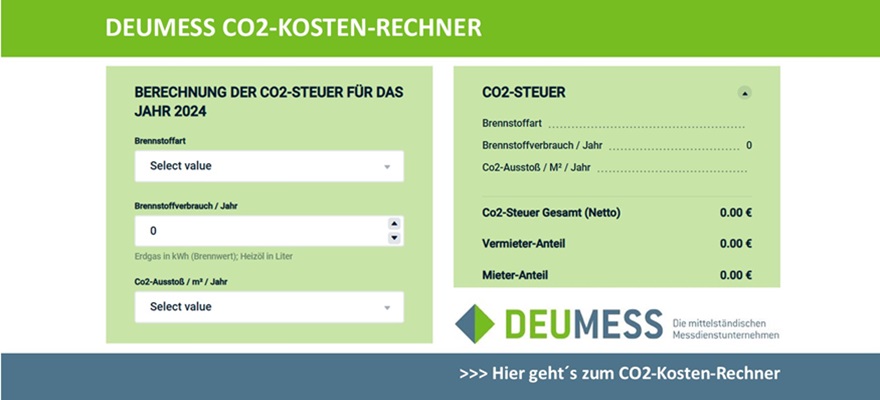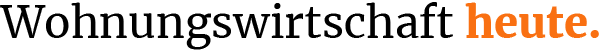Wer heute beim ressourcenschonenden Bauen nicht auf neue Normen und Zulassungsregeln warten möchte, braucht immer noch viel Mut und Kreativität, um hehre Ansprüche bis ins Detail durchzuhalten. Inspirierend könnte dabei ein Blick zurück in die 1970er und -80er Jahre sein – in die Zeit der Postmoderne, in der schließlich alles schon einmal möglich war …
Von Johannes Warda
„Jute statt Plastik“, so lautete einer der Slogans der ökobewegten Jahre vor knapp einem halben Jahrhundert. Die Zeit war von einer gesellschaftlich breit getragenen Hinwendung zu mehr Umwelt- und Ressourcenschutz geprägt – ein Erbe des gesellschaftlichen Aufbruchs von 1968. Zusätzlich befeuerte 1973 der Ölpreisschock mit den eindrücklichen Bildern von leeren Autobahnen die Krisenstimmung. Passend dazu hatte der Bericht an den Club of Rome im Jahr zuvor die „Grenzen des Wachstums“ ausgerufen.
Die allgemeinen gesetzlichen Standards und Normen waren noch nicht in dem Maße „umweltfreundlich“, wie wir das heute gewohnt sind. Es gab also viel Luft nach oben. Dieses Vakuum füllte eine zivile Selbstermächtigung mit Appellen an das individuelle Verhalten. Vieles von damals klingt vertraut: Plastik vermeiden, Wasser sparen, Alu-Deckel sammeln – alltagspraktisches Öko-Wissen für die Weltmeisterschaft im Mülltrennen.
Die Zukunft war gestern. Das alltagspraktische Wissen der Alternativkultur
Im Zuge des populären Selbermachens, oder anders ausgedrückt: der DIY-Kultur der Zeit, war auch der Bereich Bauen und Wohnen geradezu eine Spielwiese für gegenkulturelle Experimente. Im Kleinen – mit Grauwasserdusche oder Ziegelstein als Sparspülung – wie im Großen, wenn es darum ging, mit natürlichen Baustoffen zu bauen oder recycelte Materialien von den damals noch viel sichtbareren Müllkippen und Schuttplätzen zu nutzen.
„Öko-Architektur: Bauen mit der Natur“, titelte Der Spiegel 1984 und fächerte das ganze Spektrum alternativen Bauens auf. Neben den gelebten Öko-Utopien aus Kalifornien porträtierte die Titelstory auch handfestere Alternativen für ein breiteres Publikum und zeigte damit: Das „Öko-Haus“ wurde vielen ein Begriff. Das ökologisch bewusste Bauen war aus der Nische getreten – mit einem freilich noch geringen Anteil am gesamten Bauvolumen.
Landauf, landab aber entstanden nun Öko-Häuser oder gleich ganze Öko-Siedlungen. Letztere beförderten auch die Entwicklung einer neuen, integrierten und partizipativen Planungskultur: Wohnmodelle, Flächen- und Energiebedarf, Quartier- und Nachbarschaftsvernetzung wurden zusammen gedacht und möglichst ressourcenschonend umgesetzt. Ebenso wurde der Altbaubestand vieler Städte zum Reallabor für wertschätzende Alternativen zu Abriss und Neubau. Zunächst aus Protest gegen die Abrisssanierungswellen und die Abschreibungsobjekte der Bauwirtschaft, dann avancierte die erhaltende Erneuerung vor allem der gründerzeitlichen Wohnbebauung zum Modell behutsamer Stadtentwicklung.
Denkmalschutz als Umweltschutz
„Bauen“, um es mit dem Titel der vielzitierten Publikation des Schweizer Architekten Rolf Keller von 1973 zu sagen, galt vielen als „Umweltzerstörung“. Die Ergebnisse des „Neubauwahns“ und der „Abrisswellen“ konnten bundesweit besichtigt werden. An prominenten Stimmen, die bereis in ihren jungen Jahren für ein anderes Planen und Bauen eintraten, hatte es nicht gefehlt. Mit Lucius Burkhardt und Frei Otto sind nur die bekannteren genannt. Eine unmittelbarere Wirkung auf das Baugeschehen, so scheint es aus heutiger Sicht, konnte zunächst allein der Denkmalschutzgedanke erzielen.
Lag es vielleicht an der Nähe zum populären Thema Umweltschutz? Etwas zu schützen, das den zerstörerischen Gestaltungskräften der Menschheit ausgesetzt war, fand viel Zuspruch und Unterstützung auf allen Ebenen. Aus der Rückschau könnte man sich das so erklären: Ein System mit seinen Institutionen und Honoratioren versetzte sich in den Modus der Selbstkritik und verschaffte sich Momente des Innehaltens um des Erhaltens willen. Genau das passierte durch die europäische Initiative des Denkmalschutzjahres 1975, die hierzulande eine besondere Durchschlagskraft erzielte und den Denkmalschutzgedanken nachhaltig in allen öffentlichen Bereichen verankerte. Die Kampagne von oben traf dabei vielerorts auf Initiativen von unten, die um abrissgefährdete Häuser und bedrohte Nachbarschaften kämpften.
Der Slogan einer Plakatkampagne des Denkmalschutzjahres brachte es auf den Punkt: „Unser Lebensraum braucht Schutz – Denkmalschutz“. Hunderttausendfach wurde er bundesweit plakatiert und 1976 auch als Autoaufkleber verteilt. Mit einem Denkmalschutz-Aufkleber durch die autogerechte Stadt fahren – das war die postmoderne Dialektik der Zeit. Heute wäre das wieder stimmig, ist diese Stadt mit ihren Hochstraßen und Parkhäusern doch schon längst Denkmal ihrer selbst. Und das Auto trägt natürlich ein H-Kennzeichen, weil es, den subventionierten Verschrottungsaktionen entkommen, zum gut gewarteten Zeugnis ressourcenschonender Werterhaltung geworden ist.
Ressource Bestand
Aber was, wenn die kritische Masse für eine Erhaltung nicht mehr erzeugt werden kann? Die denkmalpflegerische Perspektive bedeutet immer auch ein Stück weit Gelassenheit. Denkmalpflege kann loslassen. Wenn ein Erbe nicht angetreten wird, bleibt zumindest die bauforscherische Dokumentation des Objektes für das kulturelle Gedächtnis. Und es bleiben die physischen Bestandteile als materielle Werte – es braucht nicht als Bauschutt abgeschrieben zu werden.
Dafür ist ein Material- und Bauwissen erforderlich und die entsprechende Erfahrung für die Bergung von Material und Teilen. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war der sogenannte selektive Rückbau weit verbreitet. Diese Praxis des händischen Abbauens von Gebäuden, die Einlagerung und Aufbereitung von Bauteilen und Materialien verfügte über eine ganz eigene Infrastruktur: Bauteillager, Bergehöfe und Bauteilbörsen, die heute weitgehend Nischenangebote für die Denkmalpflege sind, waren fast in jeder Kommune vorhanden.
Viele Untere Denkmalschutzbehörden betrieben eigene Lager. In einigen Kreisen und Kommunen gingen alle Abrissanträge über den Tisch der Denkmalpflege, so dass die Behörde ihre Rückbautrupps losschicken konnte, um Balken, Ziegelsteine, Dachpfannen, Kastenfenster, Türen und andere Ausstattungsteile zu sichern. Und engagierte Architekturbüros wussten genau, wo gerade ein Abriss geplant war, bekamen Material sogar angeboten. Spuren dieser Praxis sind bis heute in den Objektakten der Denkmalämter dokumentiert, wenn es etwa heißt, dass für eine Reparatur geborgene Baustoffe verwendet wurden.
Heute wird der Baubestand als anthropogenes Lager geführt, das mittels Urban Mining ausgebeutet werden kann. Fassaden- und Ausstattungsteile wie jüngst vom Redaktionsgebäude der F.A.Z. an der Frankfurter Hellerhofstraße (das eigentlich eine erhaltens- und umbauenswerte Ikone für sich gewesen wäre) können termingerecht (wenn Aus- und Einbautermin matchen) auf Online-Plattformen erworben werden. Warten wir also auf digitale Material- und Gebäudepässe? Oder stärken wir die Hüter des Wissens um den Baubestand, die Bau- und Denkmalämter mit ihren Objektakten? Den ressourcenökonomischen Impact aus einem erhaltenden und wertschätzenden Umgang mit dem Bestand in der Breite brauchen wir jetzt. Es könnte sich also lohnen, gleich dort anzusetzen, wo und wie das Baugeschehen derzeit noch hoheitlich gemanagt wird.
Ausbildungsoffensive für das Handwerk, Schelte für die Industrie
Der plötzliche Boom des Denkmalschutzgedankens in den 1970er Jahren stellte alle Beteiligten vor ungeahnte Schwierigkeiten: Wer sollte die denkmalwerte Bausubstanz denkmalgerecht erhalten? Neben der finanziellen war dies vor allem eine praktische Herausforderung. Viel Handwerkswissen war zwischen neuen Produkten und den Vorstellungen zeitgemäßer Standards verloren gegangen.
„Getestet“ wurden die Unvereinbarkeiten von den Errungenschaften aus dem Baustofflabor mit der Palette natürlicher Baumaterialien am Objekt. Ein großer Freilandversuch, der auch hochkarätige Denkmale und Kunstwerke schädigte, durch Spritzverfahren, Sanierputze oder kunststoffhaltige Oberflächenbeschichtungen. Es fehlte an Wissen und vielleicht auch ein bisschen der Mut, sich auf das zu verlassen, was zwar arbeitsintensiv war, aber sich jahrhundertelang bewährt hatte. Da sich das Bauwesen nicht, wie einige Denkmalpfleger im Wiederaufbau nach 1945 gefordert hatten, nach den Prämissen von Handwerklichkeit und lokaler Baustoffverfügbarkeit reorganisiert hatte, musste man sich viele Kenntnisse wieder aneignen. Es wurden Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote für das Handwerk in der Denkmalpflege entwickelt, die bis heute Bestand haben.
In den 1980er Jahren griff sogar eine Kampagne des Europarates dieses Thema auf. Und auch um die, wenn man so will, Gegenseite kümmerte man sich: die in den 1970er Jahren viel gescholtene Baustoffindustrie. War sie es doch, die in den Augen vieler Altstadtbegeisterter für den „Bauwirtschaftsfunktionalismus“ verantwortlich war und den historischen Baubestand mit ihren seriellen Bauteilen verunstaltete. Wegen zahlreicher als aggressiv empfundenen Werbekampagnen, in denen Hersteller für den Einsatz ihrer Produkte im Altbau warben, liefen sogar Beschwerdeverfahren von Landesdenkmalämtern bei Ministerien und Behörden.
Die Spitzenverbände der Denkmalpflege reagierten mit einer Charmeoffensive und luden im Fahrwasser des populären Denkmalschutzjahres 1975 Vertreter von Schüco, Eternit und Co. zu Gesprächen ein. Die BayWa und der Werkbund Bayern entwickelten gar ein gemeinsames Prädikat für besonders gelungene „landschaftsgerechte“ Bauteile (was freilich mit Denkmalpflege und denkmalgerechter Materialwahl weniger zu tun hatte als mit dem elitären Versuch, die Baukultur auf dem Lande zu heben).
Ästhetische und ressourcenökonomische Steuerungsinstrumente im Hochkapitalismus aber waren von begrenzter Reichweite – das mussten auch die Aktiven dieser Jahre erfahren. Viele Fragen, die oftmals noch mit dem ideologischen Ballast der Heimatschutzbewegung vom Anfang des 20. Jahrhunderts behaftet waren, sind also bis heute ungelöst und warten auf neue Lösungsimpulse im Prozess der Bauwende.
Dr. Johannes Warda ist Historiker und Architekturwissenschaftler. Er lehrt im Masterstudiengang Denkmalpflege/Heritage Conservation an der Universität Bamberg und forscht zu den ressourcenökonomischen Aspekten von Denkmalpflege. Veröffentlichungen dazu sind u. a. Von Wärmeschutz bis Klimawandel. Die Fachverbände der Denkmalpflege und die Politik der „Bauwende“ seit den 1970er Jahren (2022), Veto des Materials. Denkmaldiskurs, Wiederaneignung von Architektur und modernes Umweltbewusstsein (2016), Architektur aufbewahren. Zur Ideengeschichte des Gebäuderecycling (2016), Architektur reparieren in der „Wegwerfgesellschaft“. Zur ressourcenökonomischen Dimension des Denkmalbegriffs (2015). Als Geschäftsführer und Redakteur arbeitete er bis 2021 im Team von wohnungswirtschaft-heute.de und Schleswig-Holstein. Die Kulturzeitschrift für den Norden.
Und heute?
Viele Abrisswellen und Klimakrisen weiter, stehen wir mit Blick auf die Klimarelevanz jeglicher Bauprozesse vor ähnlichen Herausforderungen wie 1973. Allerdings wissen wir heute, dass wir nicht noch einmal die Zeit haben, Ideen für ein alternatives Wirtschaften für 50 Jahre zu vergessen. Zu unwirtlich sind die Hitze- und Flutsommer geworden, als dass die Flächenversiegelung und der Raubbau an den natürlichen Ressourcen im derzeitigen Maß weitergehen könnten.
Eine denkmalpflegerische Perspektive kann dabei helfen, eine Vorstellung von den oft noch mit der Schreckenserzählung der Regression und des Wohlstandsverlusts verbundenen suffizienten und ökologisch konsistenten Wirtschaftsweisen zu gewinnen: Die Welt ist schon gebaut. Sie zu unterhalten und klimagerecht umzubauen, ist Aufgabe genug. Die Stärke des Denkmalschutzgedankens liegt dabei in der Verknüpfung kultureller und materieller Werte. So lässt sich die Bedeutung eines Objektes sowohl über seine historische Bedeutung herleiten und zugleich – solange es Leerstand und Verfall gibt – als Potenzial für eine zukünftige Entwicklung begreifen. Praktische Denkmalpflege als suffizientes Wirtschaften lässt sich mit drei wesentlichen Strategien beschreiben:
• Instandhaltung und Pflege
• Materialgerechte Reparatur
• Erhaltung durch (Um-)Nutzung
Aber gilt das nicht nur für Bauten, deren Spektrum natürlicher Baustoffe wir handwerklich überblicken können? Was ist mit der vor 50 Jahren schon so genannten „Wegwerfarchitektur“? An dieser Stelle lohnt noch einmal ein Blick zurück auf die eingangs erwähnten Hochstraßen und Parkhäuser oder die Bürotürme mit verklebten Asbestfußböden: Auch sie sind Denkmale und verdienen eine denkmalgerechte Behandlung.
Nur sieht diese hier etwas anders aus: Im Denkmalbestand sind Schadstoffe womöglich besser gebunden als auf einer Deponie. Und im Zweifel müsste hier auch nichts mit problematischen Materialien repariert oder ergänzt werden. Die Theorie der praktischen Denkmalpflege bietet mit Konzepten wie dem des minimalen und reversiblen Eingriffs, der Sichtbarmachung und Ablesbarkeit von Veränderungen oder auch dem unmittelbaren Kontrast von alt und neu viele Möglichkeiten, auch solche Objekte denkmalgerecht instandzusetzen oder umzubauen, von denen uns noch kein so großer zeitlicher Abstand trennt, und die dadurch vielleicht normaler erscheinen, das Besondere erst auf den zweiten Blick preisgeben.
Niemand wird jedoch fordern, einen Asbestfußboden neu zu verlegen. Die denkmalpflegerische Perspektive steht für eine grundsätzliche Wertschätzung des Vorhandenen – und schließt dabei die Spuren der Zeit und das Weiterbauen als Erhaltungsstrategie selbst mit ein. Sich daran für die Gestaltung der Bauwende zu orientieren, ist erlaubt und erwünscht. Übrigens auch ohne alles mit einem Denkmallabel versehen zu müssen.