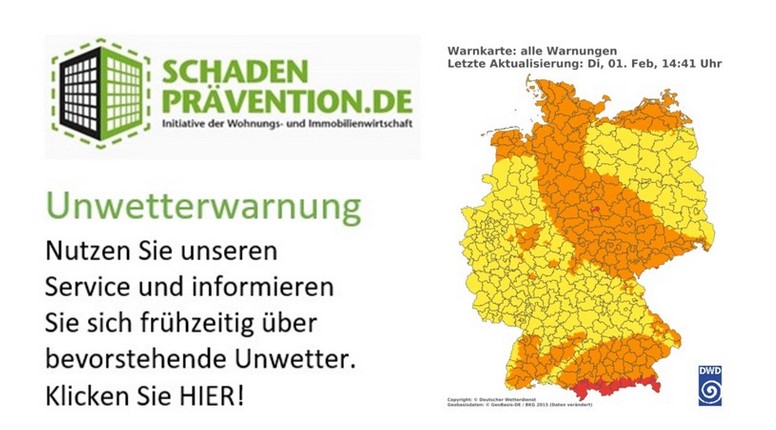Bei ss|plus architekten wird die Übergabe an die nächste Generation vorbereitet. Wir waren zu Besuch, um über Vergangenheit und Zukunft zu sprechen.
FRANZISKA LEEB
Cornelia Schindler und Rudolf Szedenik sind seit 1992 gemeinsam tätig – zunächst im Büro Lautner-Scheifinger- Szedenik-Schindler (LSSS), ab 2000 führten sie das Büro s&s architekten. In die 2014 gegründete ss plus architektur ZT GmbH stiegen mit Katja Lederer und Alexandra Reinsperger- Bakkouri zwei langjährige Mitarbeiterinnen als Gesellschafterinnen ein. Die Übergabe ist als Zehnjahresprozess angelegt, bei dem sukzessive Büroanteile an die jüngeren Partnerinnen übergehen und Schindler und Szedenik sich peu à peu zurückziehen.
Euch beschäftigten nachhaltige Themen schon, als sie noch skeptisch beäugt wurden.
Schon beim Ökohaus Puchsbaumplatz, das 1991 in Angriff genommen wurde, gibt es ein begrüntes Dach und eine Solaranlage. In der autofreien Mustersiedlung wurde dies wenige Jahre danach im großen Maßstab ein Thema. Später folgte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Passivhaus, das im Bemühen um möglichst kompakte Baukörper viel Einfluss auf die Architektur hatte.
Katja Lederer
eben der Ökologie war uns stets Mitbestimmung ein Anliegen. Am Puchsbaumplatz wurde jede der zwölf Wohnungen einzeln geplant. Die Grundidee war, dass es dazu eine Tragstruktur ohne Scheiben braucht. Im Unterschied zu späteren Projekten hat es eine sehr rigide Fassade und mit den französischen Fenstern und Schiebeläden eine Grandezza, die sich über die Jahre gut gehalten hat. Darüber sollte man wieder nachdenken.
Cornelia Schindler
Die „Autofreie Mustersiedlung“ war größenmäßig ein anderes Kaliber.
Die Bauträgerwettbewerbe – das war der dritte überhaupt – haben vieles erst ermöglicht. Michaela Mischek von der Domizil hatte eine unbändige Fantasie und die Kraft, gute Ideen anderer durchzusetzen. Ich hatte ein Schweizer Vorbild mit einer gerasterten Grundstruktur, die viel Freiheit im Inneren erlaubte. Das hat uns zur Mitbestimmung bei den Grundrissen angeregt.
Cornelia Schindler
Wichtig waren die 2,60 Meter tiefen Laubengänge, damit auch dort etwas passieren kann.
Rudolf Szedenik
Das Projekt war aufgrund seiner Größe mit 240 Wohnungen echt aufwendig. Das brachte uns viel Anerkennung ein, hatte aber auch zur Folge, dass die Mitbestimmung eine Zeitlang niemanden interessiert hat. Nachdem die soziale Nachhaltigkeit als Beurteilungskriterium Einzug hielt, konnten wir mit der BWS das „so.vie.so – Sonnwendviertel solidarisch“ umsetzen. Es war noch stärker mitbestimmt als die Autofreie Mustersiedlung.
Die Nachfrage nach Vier-Zimmer-Wohnungen war mangels Angeboten am Wohnungsmarkt riesig. Die Leute konnten mit uns umplanen und innerhalb eines Rahmens die Balkonlänge wählen. Es gelang sogar, dass auch die Bewohner, denen vom Wohnservice Wien eine Wohnung zugeteilt wurden und die normalerweise außen vor sind, mitbestimmen konnten.
Cornelia Schindler
Welche positiven Effekte bewirkt eine intensive Mitbestimmung?
Beim so.vie.so haben die Bewohner eine digitale Plattform aufgesetzt. Auf dieser wurde vieles selbst gelöst, statt Frust bei der Hausverwaltung abzuladen. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt, aber sie werden anders ausgetragen. Die Mitbestimmung hat nicht zuletzt auch dank unserer Projekte einen bestimmten Stellenwert bekommen, ist aber – was die Partizipation bei den Grundrissen angeht – wieder abgeflacht.
Cornelia Schindler
Was bedeutet das für die Architektenarbeit?
Es macht vieles einfacher.
Katja Lederer
Auch weil wir von den Soziologen Jahre
Alexandra Reinsperger-Bakkouri
später noch wertvolles Feedback bekommen,
wie etwas funktioniert.
Architekten haben Interesse an der Planung, Bauträger an den Kosten. Soziologen haben kein unmittelbares Interesse. Sie werden von den Leuten als neutral wahrgenommen und fast freundschaftlich akzeptiert.
Cornelia Schindler
Welche Lerneffekte brachte die Beschäftigung mit Partizipation mit sich?
Es stören dauernd die Schächte. Also haben wir den horizontalen Schacht entwickelt, wobei man sagen muss, dass etwa zeitgleich auch Rüdiger Lainer begonnen hat, diese Idee zu verfolgen. Die Rohre werden dabei in einer abgehängten Decke im Mittelgang geführt.
Damit spart man pro Wohnung einen halben Quadratmeter und gewinnt an Flexibilität. Wir geben unsere diesbezüglichen Erfahrungen gern weiter.
Cornelia Schindler


Welche Änderungen habt Ihr im Lauf der Zeit wahrgenommen?
Als junge Architekten waren wir entsetzt über die Mittelgangerschließung im Wohnpark Alterlaa. Heute zwingen die hohen Dichten, die man nur mit großen Tiefen erreicht, zum Mittelgang.
Rudolf Szedenik
In den Anfangsphasen des Grundstücksbeirats waren Mittelgang-Projekte so verpönt, dass sie sofort ausgeschieden wurden. Ich war damals der Meinung, dass man diese Typologie nicht völlig verdammen dürfe. Aufgrund geringerer Dichten war der Zwang dazu nicht so groß.
Cornelia Schindler
Ich stehe– um weniger Land zu verbrauchen – schon zur Dichte.
Rudolf Szedenik
Weniger Versiegelung durch Höhe – manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein Totschlagargument. Es fühlt sich anders an, wenn ich durch ein Quartier mit einer Dichte von 2,8 gehe, als durch eines mit 3,4.
Cornelia Schindler
Warum gelingt es kaum, dass innerhalb neuer Quartiere ein einheitliches Stadtbild entsteht?
Die Frage ist, ob man ein einheitliches Erscheinungsbild verordnen kann, oder ob die aktuellen Stadtbilder ganz einfach ein Abbild unserer sehr heterogenen Gesellschaft sind.
Rudolf Szedenik
Braucht es für die diverser gewordene Gesellschaft auch neue Grundrisstypologien?
Ja. Für unser Projekt im Quartier „An der Schanze“ haben wir das Konzept „Kinder im Zentrum“, entwickelt. Dabei geht es darum, dass die Kinder nicht ständig Wohnung wechseln müssen.
Es kann auf der einen Seite ein Elternteil, auf der anderen der andere oder die Großeltern wohnen. Die Kinder sind in der Mitte und können nach Belieben Türen öffnen oder schließen. Wir wollen hier in einem kleinen Rahmen erproben, ob es funktioniert.
Cornelia Schindler
Welche Faktoren schränken derzeit am meisten ein?
Das ist eindeutig der Kostendruck, der alle paralysiert. Man kann zwar darauf reagieren, ist aber in vielerlei Hinsicht eingeschränkt.
Katja Lederer
Schlimm finde ich, dass die immer kleiner werdenden Wohnungen schlecht an verschiedene Lebensphasen anpassbar sind. Sie tragen zwar dazu bei, die Mieten niedrig zu halten, aber wenn man dauernd umziehen muss, sobald sich in der persönlichen Situation etwas ändert, kommen auf die Menschen auch Kosten zu, die vermeidbar wären.
Alexandra Reinsperger-Bakkouri


Was sind die Leitbilder für die nächste ss|plus Generation?
Wir sind mit diesem Büro vom Studium weg gewachsen. Es gibt genug Themen, die wir weiterführen wollen.
Katja Lederer
Das Wichtigste ist, dass sich die Menschen wohlfühlen. Dabei geht es auch um das Wohnumfeld.
Alexandra Reinsperger-Bakkouri
Ist Rudi Szedenik tatsächlich der einzige Mann im Team?
Es hat sich so ergeben. Wir hatten eine Zeitlang einen weiteren Quotenmann. Wir sind ein gut eingespieltes Team, es herrschen freundschaftliche Verhältnisse und wir gehen gerne ins Büro.
Alexandra Reinsperger-Bakkouri
Es war immer sehr angenehm. Unangenehm war nur, wenn mir meine männliche Art vorgeworfen wurde, weil ich zu laut geworden bin.
Rudolf Szedenik