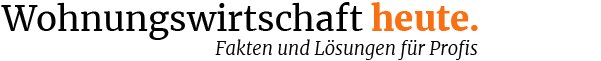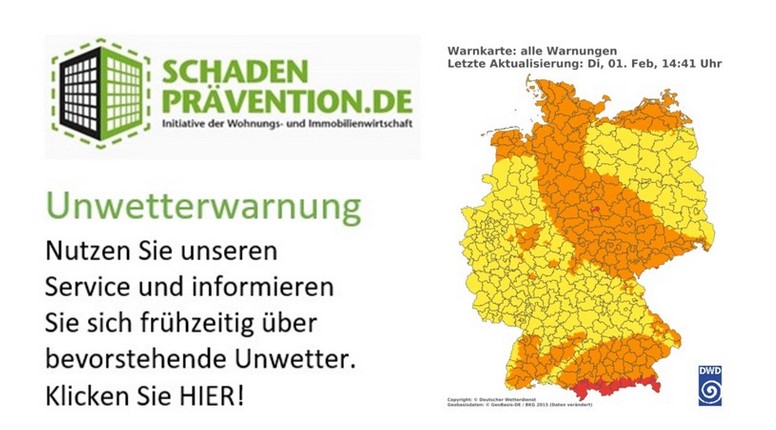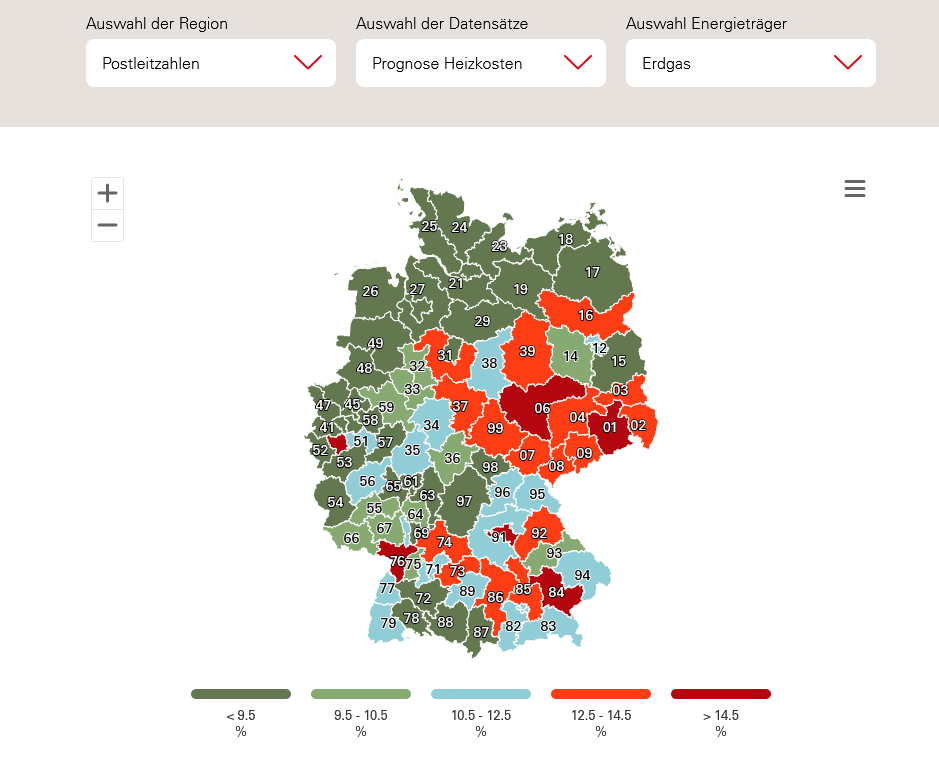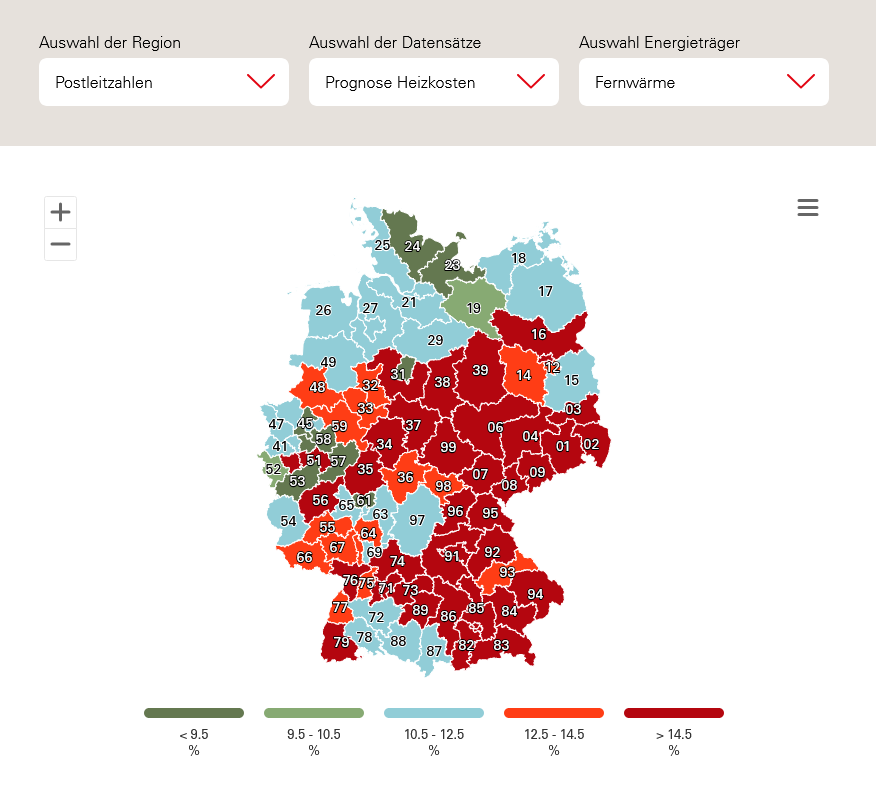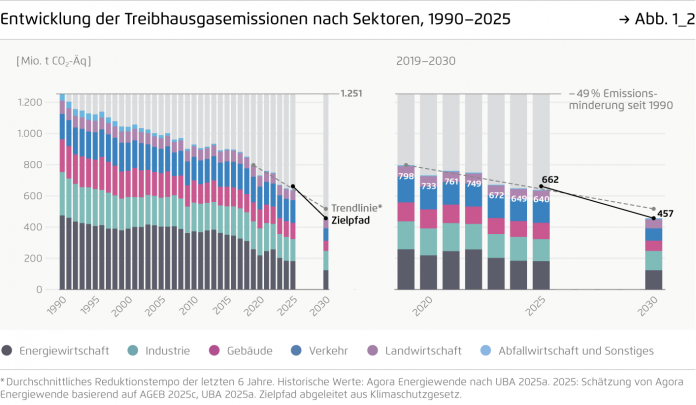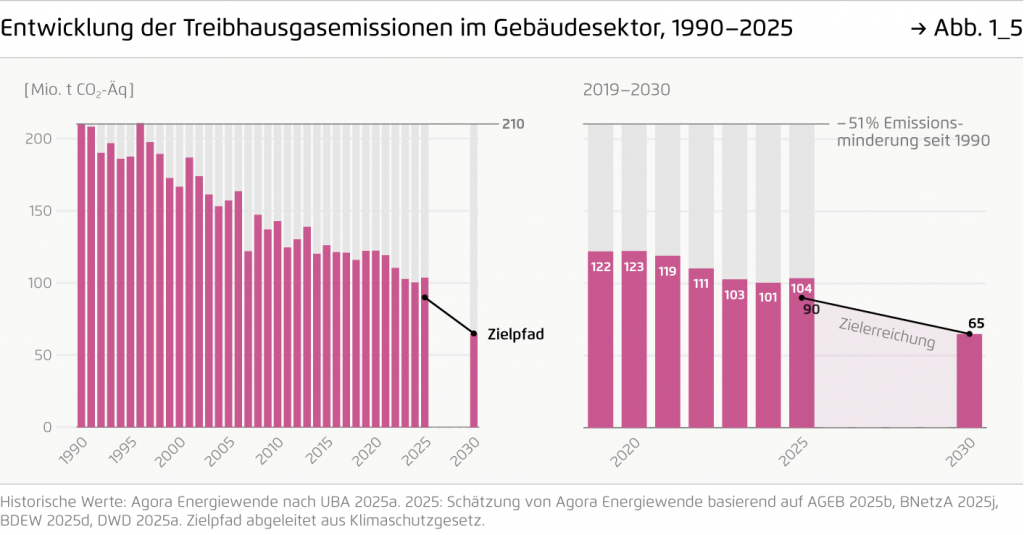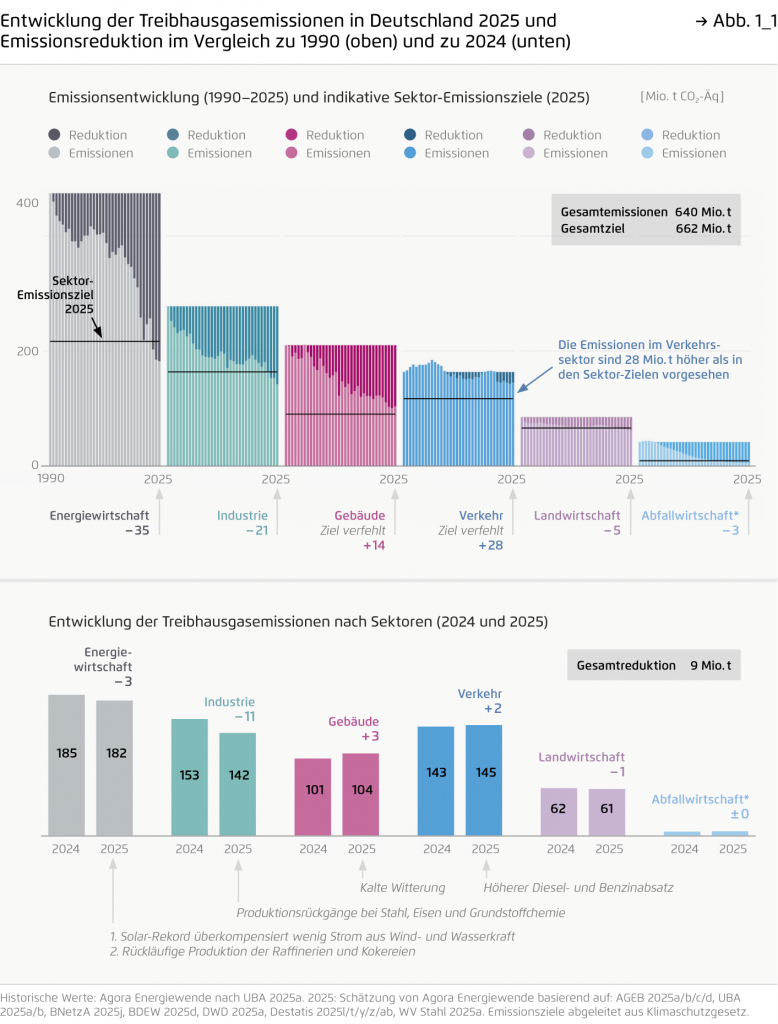Die Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG und der Wärmenetzbetreiber HanseWerk Natur zeigen im Wohnquartier “Stellinger Linse” im Hamburger Norden, wie eine klimaschonende Wärmeversorgung wirtschaftlich tragfähig und mieterfreundlich gelingen kann – wenn Gebäudestandards und Quartiersstrukturen zusammenpassen.
So bleiben die Wohnungen in der Stellinger Linse im Winter warm
Gemeinsam mit HanseWerk Natur hat die Baugenossenschaft ein Konzept auf drei Säulen entwickelt: einem hocheffizienten Blockheizkraftwerk mit dem erneuerbaren Brennstoff Biomethan, großflächiger Solarthermie in Verbindung mit intelligent regelnden Wärmespeichern und der Anbindung ans Fernwärmenetz für die verbleibende residuale Wärmelast.
Über 70 Prozent der benötigten Wärme entstehen direkt im Quartier, 30 Prozent kommen aus dem Hamburger Fernwärmenetz West. Diese ergänzende Fernwärme ist aktuell nur zum Teil erneuerbar, soll aber bis 2030 auf mindestens 60 Prozent sowie bis 2040 vollständig schrittweise auf erneuerbare und auf Abwärme basierende Erzeugung umgestellt werden.


Im Mittelpunkt der Wärmeversorgung steht ein Biomethan BHKW mit fast 2.000 Kilowatt thermischer und mehr als 1.500 Kilowatt elektrischer Leistung. Es nutzt Kraft-Wärme-Kopplung, um gleichzeitig Strom und Wärme zu produzieren. Der Primärenergiefaktor liegt künftig bei 0,26 – deutlich niedriger als bei vielen großen städtischen Fernwärmenetzen.
Jährlich produziert die Anlage bis zu 12.000 Megawattstunden Wärme und rund 11.700 Megawattstunden Strom direkt vor Ort im Hamburger Nordwesten.
Rund 525 Megawattstunden Wärme pro Jahr vom Dach
Etwa 1.200 Quadratmeter Solarthermie auf den Hochhausdächern liefern rund 525 Megawattstunden Wärme pro Jahr. Sie decken damit fünf bis sechs Prozent des Wärmebedarfs. Moderne Wärmespeicher mit insgesamt 70 Kubikmetern Volumen ermöglichen es, die Solarwärme auch abends und in Verbrauchsspitzen bereitzustellen.


Nach Überzeugung von Dr. Gerta Gerdes-Stolzke, Sprecherin der Geschäftsführung von HanseWerk Natur, zeige das Quartier, wie die Wärmewende im urbanen Raum funktionieren könne. Durch den Einsatz von Biomethan, Solarthermie und moderner Technik ließen sich die CO₂-Emissionen im Vergleich zur vorherigen Wärmeversorgung deutlich reduzieren.
Sandra Koth, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG, sagt:„Klimaschutz steht schon lange ganz oben auf unserer Agenda. Mit der Wärmeversorgung in der Stellinger Linse gehen wir einen großen Schritt in Richtung klimaneutralen Wohnungsbestandes und werden unserer sozialen Verantwortung gerecht, indem wir unseren Bestand langfristig sichern und zukunftsfähig weiterentwickeln.“


Dieses Zusammenspiel aus Klimaschutz und nachhaltigen Lösungen ist für die Wohnungswirtschaft ein zentraler Entscheidungsfaktor bei Quartiersprojekten.
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit auf andere Quartiere?
Das Wärmekonzept für die Stellinger Linse ist passgenau entwickelt worden, aber die Grundprinzipien sind auf ähnliche Quartiere übertragbar.
Wichtige Bedingungen:
- hohe Wärmebedarfsdichte in Mehrfamilienhausquartieren
- kurze Leitungswege und geringe Netzverluste
- Dachflächen für Solarthermie oder PV
- vorhandene Modernisierungsstandards oder zumindest moderate Sanierungsstände
- Kooperationsfähigkeit der Eigentümerstrukturen
Hendrik Voß, Programmleiter für die Dekarbonisierung bei HanseWerk Natur sieht in Wärmenetzen eine potenziell kosteneffiziente Option für die Wohnungswirtschaft, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes zu erfüllen. Klimaschutz sei unter den richtigen Rahmenbedingungen einfacher, günstiger und sozialverträglicher umsetzbar als durch umfassende Gebäudesanierungen oder individuelle Wärmepumpenlösungen. Das gilt jedoch nur für Quartiere mit hoher Wärmebedarfsdichte und einer geeigneten Netzinfrastruktur.


Das Beispiel der Stellinger Linse zeige, wie eine zukunftsfähige Wärmeversorgung im urbanen Quartier funktionieren könne – wenn Gebäudestandards, Wärmebedarfe und Partnerschaften zusammenpassen. Die Wärmewende sei kein „Ob“, sondern ein „Wann“, betont Voß. Projekte wie dieses würden zeigen, dass Klimaschutz und soziale Balance für Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen vereinbar seien.
Hendrik Voß
Die HanseWerk Natur GmbH ist einer der größten regionalen Anbieter für Wärme und dezentrale Energielösungen in Norddeutschland. Das Unternehmen betreibt über 120 Nah- und Fernwärmenetze mit einer Gesamtlänge von rund 850 Kilometern und versorgt mehrere zehntausend Privat- und Unternehmenskunden zuverlässig mit Wärme. Maßgeschneiderte Energiekonzepte und hochmoderne Anlagentechnik bringen die Wärmewende voran – im Mehrfamilienhaus-Quartier, im Krankenhaus sowie in Industrie und Gewerbe. Rund 40 Prozent der Wärme wird bereits heute auf Basis von Abwärme oder Erneuerbaren Energien erzeugt. www.hansewerk-natur.de
Die Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG verwaltet mehr als 5.100 Wohnungen in Hamburg und legt besonderen Wert auf die Zufriedenheit ihrer über 8.000 Mitglieder mit lebenslangem Wohnrecht. Schwerpunkte sind Neubau sowie umfangreiche Modernisierungen mit einem besonders hohen Investitionsanteil in energetische Verbesserungen und Klimaschutzmaßnahmen. Zudem engagiert sich die Hamburger Wohnen mit ihrem Sozialen Management und eigener Stiftung in sozialen und kulturellen Projekten sowie Aktivitäten zur Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders. Mehr unter www.hamburgerwohnen.de.