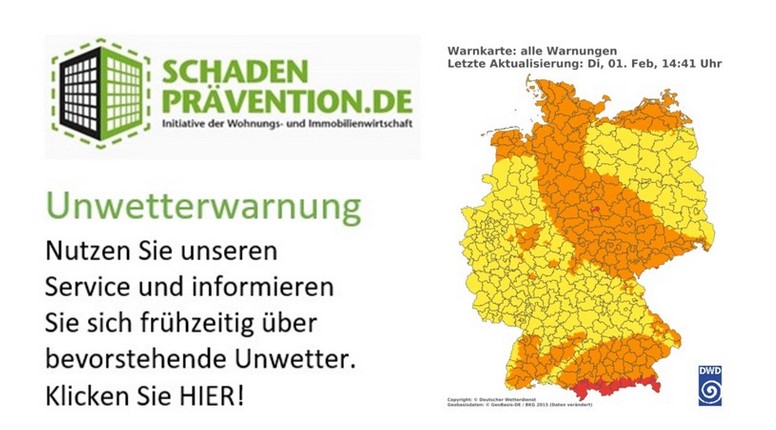Von Dr. Georg Scholzen
Heute soll es um die Hygiene und die Gefahren durch unsachgemäße Bedienung von Trinkwassersystemen gehen. Dazu passt ein aktueller Zeitungsbericht vom 04.08.2025 in den Westfälischen Nachrichten mit der Überschrift: „Duschverbot für 160 Bewohner“. Dies betraf ein Hochhaus in Münster.
Am 14.08. meldete dieselbe Zeitung, dass die Ursache der Legionellen im Hochhaus offenbar gefunden worden sei. Allerdings gilt das Duschverbot weiterhin für die 160 Bewohner, bis die Ursache abgestellt ist. Dies könnte allerdings noch einige Zeit dauern.
Was steht hinter solch einer Überschrift und welche Ursache hat eine entsprechende Anordnung des Gesundheitsamtes. Dies soll in dem Artikel näher erörtert werden.
1. Hintergrund & aktuelle Relevanz
Früher (vor 1900) waren trinkwasserbedingte Infektionskrankheiten wie Cholera, Ruhr oder Typhus häufig, die über einen fäkal-oralen Infektionsweg hervorgerufen werden. Heute stellen diese Bakterien in den meisten Industrieländern kaum noch ein Problem dar. Normalerweise stirbt bei uns niemand mehr an diesen Erregern. In den Entwicklungsländern oder in Katastrophengebieten sind diese Krankheitserreger, die sich durch eine unzureichende Trinkwasseraufbereitung vermehren, leider heute immer noch verantwortlich für viele Kranke und Tote. Vor allem sind Säuglinge und Kinder betroffen.
In den Industrieländern sind heute eher wasserleitungsbedingte Erreger relevant, wie z. B. Legionellen oder auch Pseudomonas aeruginosa. Diese Bakterien entstehen in der Hausinstallation und werden in der Trinkwasserüberwachung durch die Wasserwerke oft nicht erfasst, was auch wenig sinnvoll wäre.
Legionella pneumophila finden in warmem Wasser optimale Wachstumsbedingungen und können beim Einatmen eines aerosoliertenm Wassers (z.B. beim Duschen) Infektionen auslösen.
Pseudomonas aeruginosa sind ein ubiquitär vorkommendes, feuchtigkeitsliebendes Bakterium, dass Infektionen des Ohres und der Haut, Bindehautentzündungen, Magen-Darm-Erkrankungen und allgemeine Infektionen im Krankenhausbereich auslösen.
Das Robert-Koch-Institut rechnet jährlich mit bis zu 10.000 Menschen, die an einer Lungenentzündung aufgrund von Legionellen erkranken. Das deutsche Kompetenznetzwerk für ambulant erworbene Pneumonien (CAPNETZ) schätzt die Zahl der Legionärskrankheit auf etwa 15.000 bis 30.000 Fälle pro Jahr. Daher ist das Problem nicht zu unterschätzen.
2. Legionellen – Eigenschaften
Der wichtigste Krankheitserreger ist die Legionella pneumophila (70–90 % der Fälle). Als Krankheitsbild treten das Pontiac-Fieber (milder Verlauf ohne Lungenentzündung) und die gefährliche Legionärskrankheit (schwere Lungenentzündung) auf, die gerade für vulnerable Gruppen (Ältere Menschen, Raucher, Menschen mit geschwächten Immunsystem) problematisch sein kann.
Bei etwa 5-10% der Patienten verläuft die Erkrankung tödlich. Deutschland liegt mit einer Meldeinzidenz von 1,7 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner leicht unterhalb des europäischen Durchschnitts von 1,8. Die Erkrankungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen machen nur einen vergleichsweise kleinen Anteil aus. Allerdings handelt es sich hierbei um besonders vulnerable Patientengruppen, bei denen es oftmals zu besonders schweren bis tödlichen Krankheitsverläufen kommt.
Die Übertragung erfolgt durch Einatmen von Bioaerosolen (z. B. beim Duschen, Whirlpools, Klimaanlagen). Das Trinken von belastetem Wasser ist i. d. R. unproblematisch.

Die optimalen Bedingungen für das Wachstum von Legionellen ist ein Temperaturbereich von 25–50 °C (bei 36 °C verdoppeln sich die Bakterien alle 3 h), lange Wasserverweilzeiten, Toträume und Biofilme, in denen sie sehr gute Überlebungsbedingungen vorfinden.
Ab einer Wassertemperatur von 55 °C findet keine Vermehrung mehr statt. Ab 60 °C erfolgt ein Absterben innerhalb von ca. 30 Minuten. Je höher die Temperatur gewählt wird, umso schneller werden die Bakterien getötet. Ab 70 °C überleben die Legionellen nur noch Sekunden.

3. Biofilme
In der Regel leben Legionellen und andere Bakterien in Biofilmen. Diese sind für die Lebensgemeinschaften von Bakterien wichtig. Es sind Ansammlungen von Mikroorganismen an Grenzflächen, z.B. in Leitungen. Sie bestehen aus Wasser (bis 95 %), Extrazelluläre Polymere Substanzen (EPS, dies sind langkettige Verbindungen, auch Schleimsubstanz genannt), Mikroorganismen, Partikel und gelöste Stoffe.
In diesem Biofilm finden Mikroorganismen ideale Lebensbedingungen. Am Bach oder an einem See kennt man die Biofilme an dem schleimigen und rutschigen Belag bzw. Aufwuchs von Steinen. Dieser Biofilm lässt sich im Trinkwasser kaum verhindern und ist in der Regel auch nicht problematisch. Wichtig ist nur, dass das Gleichgewicht von Bakterien in dem Biofilm gewahrt ist und es zu keinem exponentiellen Wachstum einer Art kommt. Letztlich ist der Biofilm gut mit den Mikroorganismen im Menschen zu vergleichen. Auch hier wird es erst kritisch, wenn eine Art überwiegt und dadurch das Mikrobion eines Menschen aus dem Gleichgewicht bringt.
4. Gesetzliche Vorschriften
Die deutsche Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) schreibt in ihrer aktuellen Fassung eine regelmäßige Untersuchungspflicht für große Warmwasseranlagen mit Aerosolbildung auf Legionellen vor. Dies bedeutet für öffentliche Gebäude (Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Kitas etc.) eine jährliche Untersuchung auf Legionellen. Völlig überraschend waren die Ergebnisse in einem der ersten großen Monitoring-Programme, dass stark erhöhte Werte in Kitas gemessen wurden. Im Gegensatz dazu waren, z.B. Altenheime, weniger auffällig.
Auch Mehrfamilienhäuser, Wohnungsbaugesellschaften und Hausverwaltungen müssen seit 2011 ihren Bestand alle drei Jahre durch ein akkreditiertes Labor (§ 15 Abs. 4 TrinkwV) untersuchen lassen. Letztlich betrifft die Untersuchung seit 2011 alle Betreiber von Trinkwasserinstallationen mit Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, sofern aus diesen Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird und es zu einer Vernebelung des Trinkwassers (z. B. in Duschen) kommt.
Die Probenahme und die Analyse müssen vom geschulten Personal durch ein akkreditiertes Prüflabor erfolgen. Als Grenzwert wurde der Technische Maßnahmenwert von 100 koloniebildende Einheiten pro 100 ml (KBE/100 ml) eingeführt. Bei Überschreitung dieses Wertes muss eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen und eine Gefährdungsanalyse ist durchzuführen.
Erst durch eine Gefährdungsanalyse kann über eine Sanierung entschieden werden.
5. Technischer Maßnahmewert
In der Trinkwasserverordnung ist für Legionellen ein Technischer Maßnahmenwert von 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) je 100 ml festgelegt. Dieser technische Maßnahmewert ist erst einmal nicht gesundheitlich bedenklich. Bei Überschreitung erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt. Anhand des Wertes der KBE wägt das Gesundheitsamt die nächsten Schritte ab. Bei sehr hohen Werten, wenn eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr ausgeschlossen werden kann, erfolgt dann auch ein Duschverbot, siehe die Schlagzeile in der WN.
Dann müssen technische Maßnahmen ergriffen werden, um die Bakterien zu reduzieren. Dies beginnt mit einer Gefährdungsanalyse vor Ort bis hin zu einer ggf. erforderlichen umfassenden Sanierung der Trinkwasserinstallation. Der technische Maßnahmewert zeigt letztlich an, dass die Anlage nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und entsprechend technische Maßnahmen ergriffen werden müssen (siehe Beispiele 1-6).

6. Fallbeispiel
Dies zeigt auch ein Fall in einem Krankenhaus, welcher dem Autor bei einer Begutachtung vorgestellt wurde. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass öffentliche Gebäude, also auch Krankenhäuser schon seit langer Zeit regelmäßig auf Legionellen untersucht wurden. Allerdings ist die Untersuchung umso aufwendiger, je komplexer das Trinkwassernetz ist.
Dies verdeutlicht der folgende Fall:
In einem Bereitschaftszimmer in einem großen Krankenhaus, hat eine Ärztin nach ihrem Bereitschaftsdienst geduscht und ist schwer an einer Lungenentzündung durch Legionellen erkrankt. Es handelte sich um einen jungen, kerngesunden Menschen, der keine Risikomerkmale hatte. Das „Dumme“ war nur, dass die Bereitschaftszimmer endständige Wasserleitungen hatten und selten benutzt wurden und somit aus der Kontrollsicht fielen. Diese Leitungen waren bei den Kontrolluntersuchungen übersehen worden, weil hier keine Patienten versorgt wurden.
Daher ist es wichtig systemische Untersuchungen in komplexen Gebäuden durchzuführen, um solche Gefahren zu vermeiden.
7. Prävention & technische Maßnahmen
Entsprechend den Wachstumsbedingungen ist es sinnvoll, den Warmwasser-Boiler täglich auf mind. 60 °C aufheizen. Auch die Temperatur in der Zirkulation im Leitungsnetz ist oberhalb von über 55 °C zu gewährleisten.

Neben den Desinfektionsmaßnahmen durch erhöhte Temperaturen ist die technische Anpassung des Trinkwassernetzes unabdingbar. Dies bedeutet eine gleichmäßige Durchströmung (z. B. Strang-Regulierventile), Vermeidung von langen, verzweigten Heißwassersystemen und Totleitungen (Bilder 1,2). Empfehlenswert ist eine dezentrale Warmwasserbereitung bei selten genutzten Entnahmestellen.
Außerdem sind Kaltwasserleitungen zu isolieren, um eine zu starke Erwärmung zu vermeiden. Das Wichtigste ist aber, dass eine regelmäßige Durchspülung der Leitung erfolgt. Daher kann Wasser sparen kontraproduktiv sein. Dies alles ist in dem Merkblatt des DVGW W 551 nachzulesen. Hält man diese Anforderungen ein, besteht keine Risiko einer ungewünschten Vermehrung von Bakterien in den Wasserleitungen.
Hier die Anforderungen für Großanlagen nach W 551:
- Trinkwassererwärmer-Austrittstemperatur immer ≥ 60 °C
- Vermeidung einer großen Mischzone durch geeigneten KW-Einlauf
- Gleichmäßige Erwärmung des Wassers an allen Stellen, z.B. durch Umwälzung oder Reihenschaltung
- Dokumentation für Wartungs-, Änderungs-, und Sanierungsmaßnahmen
- gegebenenfalls örtliche Bestandsaufnahme, wenn keine Bestandspläne
- Temperaturen des Kalt-, Warm- und Zirkulationswassers sind in den Teilstrecken und an den Entnahmestellen zu messen und zu dokumentieren
Bildquelle 1-6: Dr. Georg Scholzen, eigene Aufnahmen.
Dr. Georg Scholzen ist Experte für Schadenprävention und langjähriger Autor beim Forum Leitungswasser.
Lesen Sie auch den Beitrag: Trinkwasserhygiene, Zapfstellen, Spülzyklen – Alles, was wir wissen müssen von Dr. Georg Scholzen