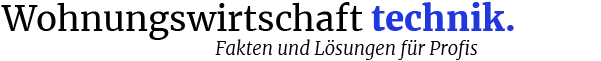Ob Stromtrassen, Windparks oder große Bauprojekte: Immer häufiger scheitern Infrastrukturvorhaben am Widerstand vor Ort. Denn Akzeptanz erreicht man nicht allein durch Zahlen, Daten und Fakten, dazu bedarf es strategischer Kommunikation mit echter Beteiligung aller Interessengruppen.
Der Experte Björn Fröbe erklärt im Interview, wie es gelingt und warum frühe Einbindung entscheidend ist. Wer nicht rechtzeitig und glaubwürdig kommuniziert, verspielt die Chance auf eine erfolgreiche Umsetzung.
Bei einem Blick in die Presse könnte man den Eindruck gewinnen, wir können keine großen Infrastrukturprojekte. Woran liegt das?
Björn Fröbe: Ich denke nicht, dass wir in Deutschland keine großen Infrastrukturprojekte mehr können. Technologisch sind wir immer noch ganz vorn dran. Große Infrastrukturprojekte scheitern nicht primär an der Technik, oftmals fehlt es an gesellschaftlicher Akzeptanz. Ursachen dafür sind unter anderem langwierige Genehmigungsverfahren, politische Kurswechsel und vor allem Kommunikationsdefizite: mangelnde Transparenz, fehlende Partizipation und widersprüchliche Aussagen. Das Urteil trifft Vorhabenträger, Politik und Verwaltung gleichermaßen.
Ob neue Windkraftanlagen, Solarparks oder moderner Bergbau, die großen Energiethemen polarisieren. Und sind damit zum Symbol der allgemeinen gesellschaftlichen Polarisierung geworden. Aber auch „kleinere“ Vorhaben wie die Erweiterung eines Schweinemastbetriebs haben erhebliches gesellschaftliches Erregungspotential.
Welche Rolle spielt Kommunikation für eine erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte?
Björn Fröbe: Planung und Kommunikation werden oft als aufeinanderfolgende Phasen gedacht. Projekte starten technisch und holen sich erst später die kommunikative Legitimation, das ist aber meist zu spät. Das erzeugt Akzeptanzlücken, die sich im Projektverlauf kaum noch schließen lassen. Wer Kommunikation und Gesellschaft nicht von Beginn an mitdenkt, bekommt meist allein dafür bereits die rote Karte. Die Folge: Der Vorhabenträger verliert das Mandat zur Umsetzung – egal wie gut das Projekt durchgerechnet ist.
Kommunikation ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Sie erhöht die Akzeptanz und minimiert so projektbezogene finanzielle und zeitliche Risiken. Interessengruppen, Beteiligte und Betroffene wollen gehört und ernst genommen werden. Meinungsbildung findet heute im direkten Austausch statt. Kommunikation formt Wahrnehmung, steuert Vertrauen und legitimiert Entscheidungen. Ohne solche Mühen wird Akzeptanz zur Glückssache.
Was bedeutet Akzeptanzkommunikation konkret?
Björn Fröbe: Meine Perspektive darauf ist klar: Akzeptanzkommunikation ist der strategische Einsatz von Kommunikation – nicht durch Überzeugung allein, sondern durch Einbindung, Transparenz und gegenseitiges Verstehen.
Sie basiert auf einem Dreiklang: Stakeholder verstehen – Kommunikation managen – Beteiligung ermöglichen. Es geht darum, relevante Anspruchsgruppen früh in den Blick zu nehmen, deren Perspektiven wahrzunehmen und durch Dialogformate die Projekte partizipativ zu gestalten.
Akzeptanzkommunikation ist keine reine PR, sondern proaktive Beziehungsarbeit. Sie zielt auf „Verstehen vor Zustimmung“, denn nur was verstanden wird, kann akzeptiert werden.
Kommunikation hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Was für Auswirkungen hat das und welche Chancen ergeben sich daraus?
Björn Fröbe: Die Kommunikationslandschaft ist dezentraler, Echtzeit-getrieben und sehr resonanzsensibel. Daher muss Kommunikation heute stets anschlussfähig, konsistent und transparent sein.
Das erzeugt jedoch auch neue Herausforderungen: professionell organisierte Kampagnen von Initiativen, divergierende Interessen und die Gefahr, Stakeholder zu übersehen, können Projekte verzögern oder sogar zum Scheitern bringen. Gleichzeitig steigt das Risiko von Missverständnissen, potenziellen Shitstorms oder Polarisierung.
Andererseits sind Dialog und Beteiligung mehr als kommunikative Instrumente – sie sind ein strategischer Vorteil. Ein durchdachtes Management der Stakeholder dient als Frühwarnsystem für kritische Themen und schützt vor dem Verlust der Reputation.
Dazu muss man Kommunikation als lernendes System und nicht als einmalige Maßnahme verstehen.
Gibt es aus Ihrer Erfahrung typische Fehler in der Kommunikation?
Björn Fröbe: Leider ja und viele davon wiederholen sich. Ein Klassiker ist der zu späte Kommunikationsstart, oft erst im Genehmigungsverfahren. Dann ist der Vertrauensvorschuss schon verspielt. Scheinbeteiligung, widersprüchliche Botschaften und unklare Zuständigkeiten erschweren zusätzlich eine vertrauensvolle Kommunikation.
Informelle Kanäle wie Gerüchte oder soziale Netzwerke werden oft unterschätzt, obwohl sie Meinungen stark prägen. Fehlende Transparenz oder gebrochene Beteiligungsversprechen wirken schädlicher als sachliche Kritik.
Wir erleben oft, dass Kommunikationsroutinen auf ‚Autopilot‘ laufen, ohne dass auf neue Signale reagiert wird. Daher ist mein Mantra: Kommunikation darf nicht operativ abgearbeitet, sondern muss strategisch geführt werden. Mit Prozessen, Methoden und fachlicher Expertise.
Ein Projekt mit hoher öffentlicher Aufmerksamkeit ist auch eine Belastung für die Beteiligten. Wie kann strategische Kommunikation auch nach innen wirken und das Team entlasten?
Björn Fröbe: Definitiv ist das so, insbesondere in turbulenten Phasen. Gute interne Kommunikation schützt – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sie gibt Struktur, sie schafft Sicherheit und sie entlastet emotional.
Außerdem verschafft sie gemeinsame Orientierung und synchronisiert das Team nach außen. Gute interne Kommunikation stiftet zudem Identifikation mit dem Projekt und schützt Mitarbeitende vor Überforderung, zum Beispiel durch klare Kommunikationslinien, abgestimmte Botschaften und definierte Zuständigkeiten.
Nur wer intern stabil ist, kann auch nach außen glaubwürdig wirken!
Das Interview führte Gudrun Huneke.