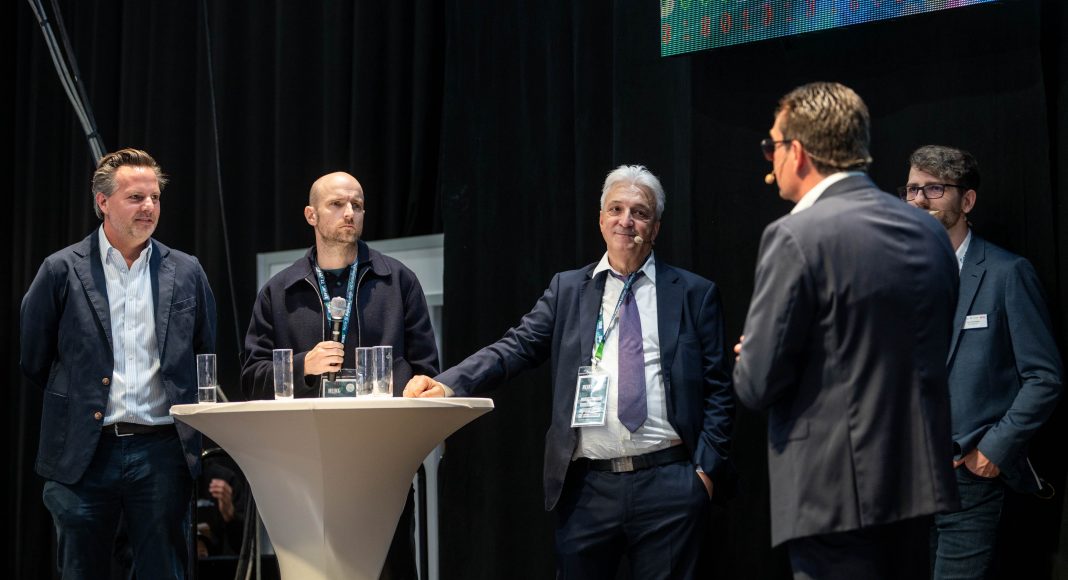Warum die Energiewende im Bestand nur mit interoperabler Software, digitalen Heizungskellern und automatisierter Abrechnung gelingen wird
Daten gibt es genug – was fehlt, ist der Plan dahinter
Digitale Heizkostenverteiler, Wasser- und Wärmemengenzähler, intelligente Stromzähler, Gateways, Heizkurvendaten, Wetterprognosen, Portale, Apps: in vielen Beständen ist die Technik längst da. Doch häufig bleibt es beim Sammeln, nicht beim Nutzen:
- Heizungsanlagen laufen nach wie vor nach statischen Parametern, nicht nach Daten.
- Abrechnungen werden über historisch gewachsene Systeme mit vielen Schnittstellen erstellt.
- Messdaten sind in Hersteller-Silos gefangen und nur mit Aufwand für zusätzliche Services (z. B. Mieterstrom) nutzbar.
Das Panel „Gebäude werden digital – was machen wir mit den Daten?“ zeigte sehr deutlich: Die Frage ist nicht mehr, ob Gebäude digital werden, sondern, wie diese Digitalisierung organisiert wird.
Die zentralen Herausforderungen
1. Insellösungen und Medienbrüche
Abrechnung, ERP, Funkdaten, Portale und Energiemanagement laufen häufig in getrennten Systemen. Daten werden importiert, exportiert, konvertiert. Jede Schnittstelle kostet Zeit und ist eine Fehlerquelle.
2. Analoge Heizungskeller in einer digitalen Welt
Während Zähler längst funkfähig sind, werden viele Kessel, Fernwärme-Übergabestationen und Wärmepumpen noch „per Hand“ betrieben. Einsparpotenziale durch bessere Regelung bleiben ungenutzt, GEG-Pflichten zur Heizungsoptimierung drohen zur Pflichtübung zu werden.
3. Vendor-Lock-in im Messwesen
Wer Zähler und Infrastruktur stellt, macht oft auch Abrechnung und Datenhaltung. Für mittelständische Messdienste und die Wohnungswirtschaft ist es schwierig, Dienste zu wechseln oder Rollen neu zu verteilen, obwohl HKVO und Digitalisierung eigentlich mehr Wettbewerb ermöglichen würden.
4. Historische Softwarekerne und steigende Anforderungen
Viele Abrechnungs- und ERP-Systeme stammen im Kern aus einer Zeit, in der Mieterstrom, E-Mobilität, CO₂-Kostenaufteilung und ESG-Reporting noch kein Thema waren. Neue Pflichten lassen sich zwar nachrüsten, aber die Kostenkurve zeigt steil nach oben.
5. Fachkräftemangel & IT-Sicherheit
Mehr Systeme, mehr Daten, mehr Schnittstellen, aber nicht automatisch mehr Personal. Gleichzeitig steigen Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz. Moderne, cloudfähige Architekturen sind hier nicht „nice to have“, sondern Grundvoraussetzung.
Fünf Blickwinkel – ein gemeinsamer Weg: Wie die Lösungen zusammenspielen
Die fünf Beiträge des Panels lassen sich als Baukasten lesen: Sie lösen unterschiedliche Teile des Problems, greifen aber inhaltlich ineinander.
1. Heizkeller und Daten in den Griff bekommen (KUGU & Green Fusion)
KUGU und Green Fusion adressieren den Ort mit der größten Hebelwirkung: den Heizungskeller.
- KUGU setzt auf digitale Zwillinge und KI-Optimierung, um Heizungen täglich automatisch auf Wetter, Gebäudephysik und Nutzerprofile einzustellen. Einsparungen von über 20 % sind in Projekten dokumentiert, mindestens 12 % werden zugesichert.
- Green Fusion versteht sich als Spezialist für den „digitalen Heizungskeller“ mit Fokus auf Gebäudeautomation und GEG-Konformität – inklusive verschiedener Wärmeerzeuger (Gas, Fernwärme, WP, BHKW, PV+WP). Einsparwerte zwischen 16 und 25 % je nach Systemtyp werden genannt.
Gemeinsam zeigen beide:
- Ohne laufende Datenerfassung und -auswertung im Keller bleibt die Energiewende im Bestand Theorie.
- Digitale Steuerung kann gleichzeitig Effizienz, Komfort und Regulatorik adressieren – wenn sie sauber in die übrige IT- und Dienstleisterlandschaft eingebunden wird.
2. Zählerdaten aus ihren Silos befreien (baeren.io)
baeren.io nimmt die Messdaten-Schicht in den Blick:
- Eine Cloud-Plattform sammelt Zählerdaten unterschiedlichster Hersteller und Funktechnologien und macht sie interoperabel.
- Dienstleistungen wie Abrechnung, uVI, CO₂-Aufteilung oder Mieterstrom können damit vom reinen Geräteeinsatz entkoppelt werden: ein Anbieter stellt Geräte, ein anderer übernimmt die Services.
- Über dieselbe Infrastruktur lassen sich zusätzlich Stromhauptzähler und Mieterstromkonzepte abbilden, ohne neue Hardware-Schichten im Gebäude aufzubauen.
Für die Wohnungswirtschaft bedeutet das:
- Mehr Wettbewerb im Messwesen,
- bessere Nutzung vorhandener Infrastruktur,
- und eine technische Grundlage, um Strom- und Wärmedaten gemeinsam zu denken.
3. Abrechnung automatisieren, statt Daten hin und her zu schieben (arasys)
arasys zeigt, was am Ende mit all den Daten passieren muss: Sie sollen zuverlässig, rechtssicher und transparent bei den Mieter:innen ankommen.
- Eine moderne Microservice-Cloud-Architektur bündelt Zählerstände, Gateway-Informationen, Montage- und Stammdaten in einem zentralen Datenhub.
- Prozesse von der Montage über Gateway-Inbetriebnahme, Funkdatenerfassung und Fehlererkennung bis zur uVI- und Abrechnungserstellung werden weitgehend automatisiert.
- Der neue Abrechnungskern HK4 ist komplett neu entwickelt und soll bis 2026 den Alt-Kern ablösen, mit besserer Performance und mehr Flexibilität für neue Geschäftsmodelle wie Mieterstrom oder E-Mobilität.
Damit schließt arasys eine Lücke: Ohne automatisierbare Abrechnung bleibt jede Datennutzung im Keller Stückwerk und die Akzeptanz der Energiewende leidet, wenn die Rechnung am Ende nicht stimmt.
4. Die Softwarelandschaft als Ganzes denken (CEOS)
CEOS zoomt eine Ebene heraus und stellt die Grundfrage der Digitalstrategie:
- Viele Unternehmen arbeiten mit einem „Flickenteppich“ aus Insellösungen: jede für sich sinnvoll, im Zusammenspiel teuer und unflexibel.
- Vorgeschlagen wird ein Softwarecluster: eine vernetzte, emergente Softwarelandschaft, in der Abrechnung, ERP, Funkdatenverarbeitung, Portale und Workflows auf einem gemeinsamen Daten- und Prozesskern aufbauen.
- Gemeinsam mit SAP und Vivawest entsteht ein erstes großes Praxisfeld für diesen Ansatz.
Der Beitrag macht klar: Wer KI im Heizkeller, Interoperabilität im Messwesen und automatisierte Abrechnung nutzen will, braucht oben drüber eine IT-Architektur, die diese Bausteine aufnehmen kann, sonst werden auch die besten Lösungen zur nächsten Insel.
Einordnung: Was heißt das für Entscheider:innen?
Die fünf Beiträge lassen sich in drei einfache Fragen übersetzen:
- Nutzen wir unsere technischen Daten bereits als strategische Ressource oder sammeln wir nur?
- Gibt es bei Ihnen bereits digitale Heizungskeller, Gebäudeautomation oder KI-gestützte Optimierung?
- Werden Messdaten (Wasser, Wärme, Strom) schon heute für mehr als nur die Jahresabrechnung genutzt (z. B. Monitoring, Mieterstrom, Benchmarks)?
- Wie interoperabel sind unsere Partner und Systeme?
- Können Sie Messdienst, Abrechnung, Energiemanagement und ERP getrennt ausschreiben und dennoch sauber integrieren?
- Haben Sie in Ausschreibungen Interoperabilität, offene Schnittstellen und Datenzugriff explizit adressiert?
- Haben wir ein Zielbild für unsere Softwarelandschaft?
- Kennen Sie den „Status Quo“ Ihrer Systeme und haben Sie eine Vorstellung, wie ein Softwarecluster in Ihrem Haus aussehen könnte?
- Passt die Roadmap Ihrer Dienstleister (Messdienste, IT, Plattformanbieter) zu Ihrer eigenen Dekarbonisierungs- und Digitalstrategie?
Was jetzt zu tun ist – in drei Schritten
1. Bestandsaufnahme: Technik, Daten, Software
- Heizung & Energie: Wo gibt es bereits digitale Heizungskeller, Gebäudeautomation oder Optimierungsansätze? Wo sind Verbräuche besonders hoch?
- Messwesen: Welche Zähler, Gateways, Funktechnologien und Plattformen sind im Einsatz? Wie interoperabel sind sie – und wem gehören die Daten?
- Software-Landkarte: Welche Systeme (ERP, Abrechnung, Portale, Energiemanagement) nutzen Sie, und wo liegen die größten Medienbrüche?
2. Zielbild definieren: Wo wollen Sie in 5 Jahren stehen?
- Sollen Heizungsanlagen durchgängig digitalisiert und optimiert sein? Und wenn ja, mit welchen Partnern?
- Wie viel Interoperabilität wünschen Sie im Messwesen (Trennung Geräte vs. Service, Nutzung für Mieterstrom etc.)?
- Streben Sie eher eine zentrale Plattform / einen Cluster an oder bleiben Sie bei Best-of-Breed mit starkem Integrationslayer?
3. Pilotprojekte aufsetzen und konsequent auswerten
- Ein Heizungsoptimierungs-Pilot (z. B. mit 5–10 Liegenschaften) kann zeigen, welches Einsparpotenzial im Bestand tatsächlich erreichbar ist.
- Ein Interoperabilitäts-Pilot mit gemischtem Gerätepark und einer Cloud-Metering-Plattform macht sichtbar, wie gut Datenströme sich bündeln lassen.
- Ein Abrechnungs-Pilot mit neuer Cloud-Architektur kann testen, wie weit Automatisierung ohne Qualitätsverlust geht, inklusive uVI und Portalen.
Wichtig: Pilotprojekte sind kein Selbstzweck. Sie sollten immer mit klaren KPIs (Energie, CO₂, Prozesszeiten, Fehlerquoten, Beschwerden) hinterlegt werden, und mit einem Plan, wie Sie erfolgreiche Ansätze ins breite Portfolio bringen.
Ohne digitale Ordnung im Hintergrund wird die Energiewende im Vordergrund teuer
Das Panel macht deutlich: Die großen Themen – Dekarbonisierung, GEG, ESG, Mieterstrom, E-Mobilität – werden sich nicht mit Excel-Listen, alten Abrechnungsprogrammen und „Heizung läuft schon irgendwie“ lösen lassen.
Stattdessen braucht es:
- Intelligente Heizungskeller, die Daten nutzen, statt nur Wärme zu produzieren.
- Interoperable Messdaten, die Hersteller-Silos aufbrechen und neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
- Automatisierte Abrechnung, die skaliert und verlässlich ist.
- Und eine Softwarestrategie, die all das zu einem funktionierenden Gesamtbild verbindet.
Wer diese Bausteine zusammendenkt, schafft die Grundlage dafür, dass Digitalisierung nicht nur Kosten verursacht, sondern Energie, Geld und Nerven spart.
Für alle, die tiefer einsteigen wollen, lohnt der Blick in die einzelnen „Deep Dives“ zu KUGU, Green Fusion, baeren.io, CEOS und arasys. Dort werden die jeweiligen Ansätze im Detail beleuchtet.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Die Wohnungswirtschaft sitzt auf einem wachsenden Berg an Mess- und Anlagendaten, nutzt ihn aber bislang nur teilweise für Effizienz, Service und neue Geschäftsmodelle.
- Im Panel „Gebäude werden digital – was machen wir mit den Daten?“ zeigen fünf Unternehmen unterschiedliche Bausteine:
- KUGU und Green Fusion: digitale Heizungskeller, KI-Optimierung, Gebäudeautomation.
- baeren.io: Interoperabilität im Messwesen, herstellerübergreifende Zählerdaten, Mieterstrom- und Stromservices.
- arasys: Cloud-Abrechnung, durchgängig automatisierte Prozesse von Montage bis uVI.
- CEOS: strategischer Blick auf die IT vom Software-Flickenteppich zum vernetzten Softwarecluster.
- Gemeinsamer Nenner: Weg von Insellösungen und Bauchgefühl, hin zu vernetzten Plattformen, die Heizung, Zähler, Abrechnung und ERP/Buchhaltung zusammenbringen.
- Für Entscheider:innen heißt das: Es geht nicht um „noch eine Software“, sondern um die Architektur dahinter und darum, wie man Daten so organisiert, dass sie Energiewende, GEG-Pflichten, ESG-Reporting und Mieterservices gleichzeitig unterstützen.
Autor: Redaktion Wohnungswirtschaft Heute – HEIKOM-Sonderausgabe 2025
Foto: DEUMESS – Frank Schütze / Fotografie Kranert