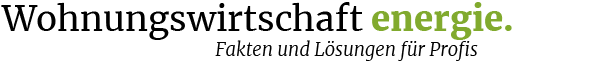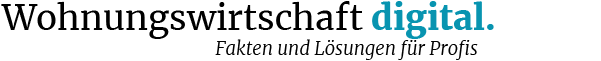von Achim Dewald, Projektleitung bei Prior1
KI-Workloads treiben die Leistungsdichten in ungeahnte Höhen, während Netze vielerorts ächzen. Wer Rechenzentren heute plant oder betreibt, muss Energieversorgung als strategischen Risikofaktor denken: redundant, messbar, rückgewinnungsfähig. Zahlen, Normen und Praxisbeispiele zeigen, was wirklich funktioniert und wo es brenzlig wird.
Warum Redundanz, Dimensionierung und Erdung über die Betriebssicherheit entscheiden und welche Best Practices jetzt tragen
Generative KI und GPU-Cluster verschieben die Stellgrößen. Laut IEA-EDNA[1] lag der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren 2023 bereits bei rund 323 TWh. Rund ein Drittel davon entfällt schon heute auf KI- und HPC-Workloads, mit weiter steil wachsender Kurve. Die Internationale Energieagentur hält bis 2030 sogar bis zu 2.500 TWh für möglich – mehr als das Sechsfache innerhalb einer Dekade. (1)
Auch im Mikrokosmos einzelner Rechenzentren verändern sich die Parameter dramatisch: Während klassische Hyperscaler-Zonen heute bei etwa 36 kW pro Rack liegen, verlangen neue GPU-Cluster inzwischen 80 bis 100 kW, Tendenz steigend. (1)
Parallel zieht die Regulierung die Schrauben an: In Deutschland gilt seit 2024 die Pflicht, mindestens 50 % Grünstrom einzusetzen, ab 2027 sind es 100 %. Neu errichtete Rechenzentren müssen ab Juli 2026 einen PUE von höchstens 1,2 erreichen; für Bestandsanlagen gilt ≤ 1,5 ab 2027 und ≤ 1,3 ab 2030. (2)
Gleichzeitig bleibt die Blackout-Debatte real. Analysen zu Versorgungssicherheit zeigen: Netzengpässe in europäischen Hotspots verschärfen das Standortrisiko erheblich. Auch in Deutschland ist unsicher, ob alle Rechenzentren die nötigen Standards für Notstrom und Redundanz tatsächlich einhalten. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der politisch wie betrieblich Druck erzeugt. (3)
Die Konsequenz ist eindeutig: Energieversorgung ist längst kein „Facility-Detail“ mehr. Sie ist der zentrale Hebel für Verfügbarkeit, Compliance und Reputation.
Was die Praxis zeigt: Typische Mängel
Prior1 hat die Mängel, die den Experten des Unternehmens in zahlreichen Praxisprojekten aufgefallen sind, systematisch erfasst und analysiert. Die Mängelliste zeigt klare Muster in den Bereichen Stromversorgung, Elektroinstallationen, Erdungsanlagen.
- Redundanzlücken: Redundanzen existieren nur „auf dem Papier“; z. B. n+1 redundante USV-Anlagen greifen auf den gleichen Batterieblock zu.
- Ersatzstromversorgung: Zu klein ausgelegte Netzersatzanlagen (Laststöße bei Übernahme), nicht ausreichende Güte der Ausführungsklasse oder keine dokumentierten Lasttests unter reellen Lastbedingungen.
- Dimensionierungsfehler: Zu knapp bemessene Leitungsquerschnitte (bzw. Nichtbeachtung von Verlegearten) und Sammelschienen, keine belastbare Kurzschlussstrom-/Selektivitätsberechnung, somit nicht erfüllte Abschaltbedingungen, fehlende Leistungsreserven.
- Erdung/Potentialausgleich: Keine homogenen Konzepte mit durchgängiger Vermaschung, Prinzip der ‚kurzen Leitungswege‘ nicht beachtet, unklare Anschlüsse von Anlagenteilen und Schirmungen, fehlende Dokumentationen und Messungen, keine oder nicht ausreichende Differenzstromüberwachungen (Granularität, Allstromsensitivität).
- Installationspraktik & Betriebsunterhaltung: Bauliche Trennung von redundanten Installationswegen, Systemtrennung von Stark-/Schwachstrom und IT-technischen Installationstrassen, Wartungsprobleme durch fehlende Abstände zwischen Anlagen und unzureichende Kennzeichnung, Betriebsrisiken aufgrund nicht durchgeführter Lastübernahme- und Umschaltprozeduren im Redundanzfall, mangelnde Visualisierung von Lastflüssen.
Diese „kleinen“ Mängel können sich im Störfall zu großen Effekten addieren.
Übergeordnetes Risiko: Ausfälle bleiben stromgetrieben
Zwischen 2022 und 2024 gingen rund 70 % der Rechenzentrumsstörungen auf Strom- und Kühlungsfehler zurück, vom USV-Versagen bis zur missglückten Rückschaltung. (4)
Fallbeispiele aus D-A-CH und Europa zeigen, wie unterschiedlich Störungen wirken können. In Wien führte 2022 ein städtischer Einspeisungsfehler kombiniert mit einem internen Umschaltproblem dazu, dass mehrere Racks minutenlang ohne Versorgung blieben, mit Folgeschäden bis auf Anwendungsebene. In Bamberg brannte 2025 ein Umspannwerk. Die angeschlossenen Rechenzentren verfügten zwar über Notstrom, doch teils fehlte die saubere Redundanz, sodass einzelne Services über Stunden offline waren. Und auch Hyperscaler sind nicht immun: Immer wieder kommt es zu Beeinträchtigungen durch fehlerhafte USV-Schaltungen oder Batterieprobleme – ein Risiko, das selbst in hochautomatisierten Umgebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. (4)
Lesson learned: Technische Redundanz allein genügt nicht. Getestete Redundanz, selektive Schutzkonzepte und saubere Erdung sind die eigentlichen Game-Changer.
Best Practices: So wird Energieversorgung wirklich resilient
Viele Ausfälle passieren nicht, weil Technik fehlt, sondern weil sie nicht richtig verschaltet, dimensioniert oder getestet ist. Die folgenden Punkte zeigen Schritt für Schritt, wie Sie aus dem Ziel „hoch verfügbar“ konkrete Maßnahmen machen: passender Aufbau der Strompfade, selektiver Schutz, robuste Erdung, saubere Trennung von Energie und Daten sowie regelmäßige, realitätsnahe Tests.
1) Architektur: Redundanzziele konsequent ableiten
Verfügbarkeit ist ein Zielniveau und Architektur die Übersetzung dieses Ziels in Technik. Als Referenzrahmen dienen die EN 50600 und die Tier-Klassifikation des Uptime Institute. Die EN 50600 mit den Verfügbarkeitsklassen VK 3/VK 4 steigert den Trennungsgrad der Strompfade schrittweise; erst VK 4 ermöglicht echte unterbrechungsfreie Wartung. Im Tier-Modell fordert Tier III eine N+1-Auslegung mit „concurrent maintainability“, während Tier IV auf 2N und vollständige Pfadtrennung setzt.
2) Dimensionierung & Schutz
Resilienz entsteht nicht durch doppelte Hardware allein, sondern durch sauber abgestimmte Schutztechnik und belastbare Dimensionierung. Selektive Koordination sorgt dafür, dass bei einem Fehler nur die nächstliegende Schutzeinrichtung anspricht. Dazu gehören korrekt ausgelegte Kurzschlussfestigkeiten sowie Leiterquerschnitte, die auch dauerhafte KI-Lasten sicher tragen.
3) Erdung & Potentialausgleich
Ein vermaschtes Erdungssystem (Mesh-Bonding) mit durchgängiger Schirmführung stabilisiert das elektromagnetische Umfeld und begrenzt Potentialunterschiede und elektromagnetische Störungen. Die technische Belastbarkeit entsteht aus sauberer Dokumentation sämtlicher Erdungs- und Schirmpunkte sowie regelmäßigen Prüfungen nach VDE.
4) Verkabelung & Trennung
Ordnung in der Infrastruktur ist ein Verfügbarkeitsfaktor. Energie- und Datenwege werden physisch getrennt geführt, ergänzt um Brandabschnitte und eindeutige Beschriftungen, die Diagnose- und Eingriffszeiten verkürzen.
5) Monitoring & Testkultur
Gefordert sind Echtzeitmessungen bis in die Unterverteilungen sowie vorausschauende Analytik für USV-Batterien. Ergänzend bilden Kennzahlen die Effizienz- und Wiederverwendungsleistung ab: PUE als Pflichtgröße und der Energy Reuse Factor (ERF) als Maß für nutzbare Abwärme.
Regulatorik & Abwärme: Compliance als Effizienz-Treiber
Die zuvor beschriebenen technischen Maßnahmen gewinnen an Schlagkraft, wenn sie durch klare Vorgaben und Messpflichten gesteuert werden. In diesem Sinne wirkt die Regulatorik als Katalysator: Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) zwingt zur Transparenz und beschleunigt Investitionen in wirksame Architektur, mit PUE-Grenzwerten, Grünstromquoten und Berichtspflichten. (2) Besonders praxisrelevant ist die Abwärmenutzung: Ab Juli 2026 sind in Deutschland mindestens 10 % für neue Rechenzentren verbindlich, inklusive Nachweisen und Schnittstellen zu Wärmenetzen; die Anforderungen steigen schrittweise an. (6)
Best Practices zeigen die Machbarkeit:
- NTT DATA koppelt in Berlin ein bestehendes Rechenzentrum direkt an ein neues Stadtquartier an. Kernstücke sind ein Wärmespeicher mit 300 m³ Volumen und ein Power-to-Heat-Kessel mit 3,6 MW Leistung. Damit lässt sich die Abwärme des Rechenzentrums so aufbereiten, dass sie für bis zu 10.000 Menschen zur Wärmeversorgung nutzbar wird – ein Maßstab, der die Bedeutung von Rechenzentren weit über ihre digitale Funktion hinaus verdeutlicht. (7)
- Ein anderes Beispiel liefert der Green IT Cube des GSI Helmholtzzentrums in Darmstadt: Die wassergekühlte Hochleistungsinfrastruktur erreicht einen PUE-Wert von rund 1,07 und nutzt die anfallende Wärme direkt auf dem Campus. Damit wird nicht nur ein Vorzeigeprojekt für Effizienz geschaffen, sondern zugleich demonstriert, wie wissenschaftliche Rechenleistung und nachhaltige Energieintegration Hand in Hand gehen können. (6)
Zukunftsarchitektur: Microgrids, PPAs, smarte Flexibilität
Wenn Netzanschlüsse zur Engstelle werden, rücken Microgrids in den Fokus: lokal gekoppelte Energiesysteme mit eigener Erzeugung aus Photovoltaik, Wind oder Biomasse, ergänzt um Batteriespeicher und intelligentes Lastmanagement. Solche Verbünde puffern Lastspitzen, halten kritische Verbraucher auch bei Netzschwankungen versorgt und entlasten zugleich das öffentliche Netz, resilient und netzfreundlich. (8)
Für Dekarbonisierung und kalkulierbare Energiekosten setzen Betreiber zunehmend auf Power Purchase Agreements (PPAs), langfristige Stromlieferverträge, die echten Grünstrombezug und stabile Preise über zehn Jahre und mehr sichern, sowohl On-Site als auch Off-Site. Ein aktuelles Beispiel liefert OVHcloud: Mit einem Solar-PPA in Deutschland werden die CO₂-Emissionen des Betriebs spürbar gesenkt. (9)
Flankierend erhöhen KI-gestützte Energiemanagementsysteme die Betriebssicherheit: Sie kombinieren Demand Response, Peak Shaving und präzisere Erzeugungs- und Lastprognosen und verbinden so Resilienz mit regulatorischen Zielen. (8)
Konkrete To-dos zur Verbesserung in Hinblick auf bekannte Mängel (Checkliste)
- Redundanz real testen: Wer die Energieversorgung im Rechenzentrum zukunftssicher gestalten will, muss an mehreren Stellschrauben gleichzeitig drehen. Dazu gehört vor allem, Redundanz nicht nur zu planen, sondern regelmäßig zu erproben, etwa durch vierteljährliche Last- und Black-Start-Szenarien, dokumentierte Runbooks und vollständige Rückschaltproben. (4)(5)
- Schutz und Selektivität prüfen: Ebenso entscheidend ist der Schutz der Netzinfrastruktur: Selektive Koordination, Kurzschlussfestigkeit und thermische Reserven von mindestens 25 Prozent sind Pflicht, gerade mit Blick auf die hohen Stromspitzen moderner KI-Lasten. (5)
- Erdung vermaschen: Ein oft unterschätzter Faktor ist die Erdung. Durchgängige Schirme, klar definierte Übergabepunkte und belastbare Messprotokolle nach VDE bilden das Fundament für eine sichere Infrastruktur. (2)
- Trassen sauber trennen: Auch die Trassenführung verdient Aufmerksamkeit: Konsequent getrennte Energie- und Datenwege, klare Brandabschnitte sowie eindeutige Beschriftungen und gute Wartungszugänglichkeit verhindern im Ernstfall unnötige Risiken. (5)
- Monitoring schärfen: Darüber hinaus gilt es, das Monitoring deutlich zu vertiefen, mit Messungen bis in die Unterverteilungen, Batterie-Analytics und KPI-Dashboards, die nicht nur PUE, sondern auch Kennzahlen wie den Energy Reuse Factor (ERF) abbilden. (2)
- Abwärme-Roadmap hinterlegen: Ein strategischer Blick nach vorn sollte nicht fehlen. Eine Abwärme-Roadmap mit definierten Wärmesenken, Temperatur-Niveaus, Speicherkapazitäten und vertraglich gesicherten Abnehmern (z. B. Stadtwerke oder Quartiere) wird zunehmend zum Standortfaktor. (6)(7)
- Regulatorik aktiv managen: Schließlich müssen Betreiber die Regulatorik aktiv managen: vom PUE-Pfad über die verpflichtende Grünstromversorgung ab 2027 bis hin zu jährlichen Nachhaltigkeitsberichten. Wer hier frühzeitig Power Purchase Agreements (PPAs) prüft, sichert sich Handlungsspielräume. (2)(9)
Ausblick: Energiearchitektur entscheidet
Mit KI steigt die kritische Abhängigkeit von verlässlicher Energie. Wer heute baut oder ertüchtigt, sollte die Energieversorgung als Produktmerkmal denken: zertifizierbar, testbar, rückgewinnungsfähig, und im Zweifel netzunabhängiger als gestern. Das minimiert Downtime-Risiken, setzt EnEfG-Pflichten smart um und schafft Freiräume für die nächste Dichte-Stufe.
Quellen:
1. https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/publikationen/2025/iea-4e-edna-bewertung-energieverbrauch-rechenzentren.php
2. https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-01/bitkom-leitfaden-energieeffizienzgesetz-fuer-rechenzentren.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/enefg/__11.html
3. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.html
4. https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2025
https://www.computerweekly.com/de/feature/Stromausfaelle-in-Rechenzentren-Ursachen-und-Vermeidung
5. https://www.tuv.com/content-media-files/germany/pdfs/1558-betriebssicheres-rechenzentrum-gem.-din-en-50600/tuv-rheinland-din-en-50600-leaflet.pdf
https://www.it-schulungen.com/wir-ueber-uns/wissensblog/was-macht-das-en-50600-regelwerk-aus.html
6. https://www.twobirds.com/de/insights/2024/germany/rechenzentren-und-abwaerme-ein-ueberblick-ueber-die-gesetzlichen-vorgaben-zur-abwaermenutzung
https://bytes2heat.de/static/files/Bytes2Heat_Best-Practice-Uebersicht_Jan_2024_deu.pdf
7. https://ch.nttdata.com/newsroom/2025/abwaerme-aus-bestandsrechenzentrum-ermoeglicht-klimaschonendes-waermekonzept
8. https://www.azuraconsultancy.com/de/microgrids-the-future-of-data-center-power/
9. https://corporate.ovhcloud.com/de/newsroom/solar-parc-germany-ppa/
[1] IEA-EDNA: International Energy Agency. Energy Efficient End-use Equipment Technology Collaboration Programme, Electronic Devices and Networks Annex.