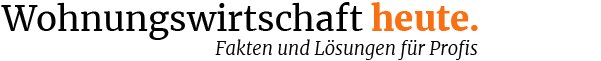Von Prof. Dr. habil. Hartmut Balder
Mit zunehmenden Wetterextremen erhöht sich in den urbanen Baumbeständen die Gefahr, dass durch Brechen von Kronen und Umstürzen der Bäume größere Sach- und Personenschäden entstehen (Abb. 1). Die aktuellen großflächigen Sturmschäden u. a. in Berlin müssen daher genutzt werden, um hieraus Erkenntnisse für die künftige Pflanzenverwendung, Baumpflege und Baumkontrolle in einer weitsichtigen Wohnungswirtschaft zu geben.
Wissensstand zur Baumstatik
Die Windbelastungen von Bäumen werden wesentlich von der Anströmrichtung und vom Baumumfeld beeinflusst. Im Schatten von Gebäuden, solitären Großbäumen oder Waldbeständen können sie mit den Jahren schiefe und instabile Kronen ausbilden. Desweiteren schwächen oder verstärken diese Wuchssituationen den Wind, Düseneffekte sind hierbei von besonderer Bedeutung (Wessolly u.a., 2014).
Ein freies Feld lässt den Wind großräumig auf Baumbestände einwirken, die Nord-Süd-Ausrichtung einer Baumallee ist bei vorrangiger Westwindrichtung besonders dem Wind ausgesetzt. Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km / Std. sind dabei keine Seltenheit. Studien aus der Luftströmungsforschung belegen, dass eine enge Pflanzdichte, große Wuchshöhe und –breite die Windstärke zunehmen lassen. (Stiftung DIE GRÜNE STADT, 2013). Die doppelte Windgeschwindigkeit bedeutet in der Regel den vierfachen Winddruck. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei Stürmen immer wieder verstärkt Schäden an Bäumen speziell
- an Kreuzungen auf der Ostseite von Gebäuden (Aufprall)
- hinter Gebäuden, ausgelöst durch Fallwinde
- seitlich von Gebäudeecken oder Vegetationsbeständen (Verwirbelungen)
- in Straßen in West-Ost-Richtung (Schluchten)
- hinter Gebäudelücken aufgrund von Düseneffekten
- bei Anströmung von freiem Feld frontal auf Baumbestände
festgestellt werden können (Balder, 2005). Augenscheinlich nehmen Schäden dort zu, wo sich Winde durch Aufprall verstärken und besonders durch Düseneffekte in ihrer Kraft potenzieren (Abb. 2).


Abb. 2: Sturmschäden durch Verwirbelungen im Umfeld von Hochhäusern
Winde wirken als horizontale oder seitliche Belastung, die Größe der Belastung hängt dabei von der Kronenfläche, der Kronenform, dem Luftwiderstand der Krone und dem Winddruck ab (Wessolly u.a., 2014). Bei Sturm kann ein Baum durch Brechen oder Umstürzen versagen. Bruchschäden entstehen, wenn der Stammdruck die Biegefestigkeit des Stammes (Schaftbruch) oder von Ästen (Ast-, Wipfelbruch) überschreitet (Abb. 3).
Ein vollholziger Baum bricht rel. stumpf ab, ein hohler hingegen nach Verformung und Längsrissbildung. Häufig brechen kleinere Äste, größere Kronenteile und die Terminalen verstärkt, wenn sie sich lang entwickeln konnten oder als einzelne Äste aus den Kronen herausragen.


Abb. 3: Kronenbruch bei Eiche
Bäume auf flachgründigen Standorten sind in ihrer Standsicherheit eingeschränkt und werden bei entsprechender Windbelastung umgeworfen. Mechanische Wurzelverluste und absterbende Wurzelsysteme nach größerer Trockenheit, Hochwasserereignissen und Befall mit Wurzelpathogenen schränken ebenfalls die Standsicherheit ein (Balder, 1998). Bricht ein Baum aus einem Bestand heraus, sind die benachbarten Bäume gefährdet, da neu exponiert (Abb. 4).


Abb. 4: Umgeworfener Baum mit flachgründigem Wurzelsystem
Durch derartige Sturmschäden werden Baumbestände für lange Zeit beeinträchtigt oder sogar völlig vernichtet. Handelt es sich hierbei um Kultur- und Naturdenkmale ist ihre Schädigung besonders beklagenswert, ortsbildprägende Baumbestände verlieren ihre ästhetische Wirkung oder hinterlassen eine kahle Fläche. Befinden sich die Bäume an stark frequentierten Verkehrsstraßen, entstehen in der Folge hohe finanzielle Aufwändungen für Baumkontrolle, Baumpflege und Nachpflanzung.
Sind dabei Sach- und Personenschäden entstanden, müssen diese gut dokumentiert werden, um Daten und Bilder für Schadensersatzforderungen bereit zu haben. Alle Entwicklungen sollten sinnvollerweise in Baumkatastern dauerhaft dokumentiert werden (Balder u.a., 2009). Nach ersten Aufräumarbeiten unmittelbar nach einem Sturmereignis müssen daher in der Nachkontrolle weitere Probleme erkannt und dokumentiert werden (FLL, 2020).
Aktuelle Erkenntnisse zur künftigen Schadensvermeidung nutzen
Baumbestände auf öffentlichen und privaten Flächen müssen nach einem Grundsatzurteil des BGH (1961) zur Herstellung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden regelmäßig kontrolliert werden. Diese Baumkontrollen werden entweder von Mitarbeitern der Ämter oder von beauftragten Dienstleistern durchgeführt, kommunale Verwaltungsvorschiften regeln in den Kommunen meist das Vorgehen.
Nach der FLL-Baumkontrollrichtline (2020) werden von den Akteuren zunächst der Stamm abgeklopft um zu hören, ob der Baum zum Beispiel hohl ist. Desweiteren werden Äste und Krone kontrolliert– in der Regel vom Boden her. Und man untersucht, ob der Baum äußerlich erkennbar von einem holzzerstörenden Pilz befallen ist oder andere Defekte vorliegen (Abb. 5). Allerdings sind nicht alle Pilzfruchtkörper dauerhaft zu sehen, manche zeigen sich nur wenige Tage und werden deshalb schnell übersehen. Diese normalen Kontrollen finden in regelmäßigen Abständen, optimalerweise mal im belaubten mal im unbelaubten Zustand statt.
Ihre Häufigkeit wird unterschiedlich gehandhabt, eine hohe Frequenz ist weniger entscheidend, sondern vielmehr die sachkundige und sorgfältige Vorgehensweise. Erst bei auffälligen Schäden müssen spezielle Folgeuntersuchungen folgen, um die Verkehrssicherheit zu bestätigen oder durch geeignete Maßnahmen herzustellen.
Hieraus können auch unpopuläre Maßnahmen folgen, u.a. Kroneneinkürzungen oder Baumfällungen. Die Politik muss diese Sachzwänge akzeptieren und der Öffentlichkeit mit guter Kommunikation vermitteln.


Abb. 5: Baumstamm mit unübersehbaren Pilzfruchtkörpern als Hinweis für innere Holzfäulen
Die Schäden, die Stürme besonders im urbanen Wohnumfeld hinterlassen, überraschen Baumeigentümer und Bevölkerung gleichermaßen. Die Wohnungsbaugesellschaften sind hiervon aufgrund ihrer Flächengröße und häufig großer Baumbestände unmittelbar betroffen.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Hintergründe ist immer wieder erkenntnisreich, vor allem in Hinblick auf potentielle Auswirkungen der Klimaveränderungen und des Stadtumbaus in der Wohnungswirtschaft. Sich allein auf Naturgewalten (höhere Gewalt) zu berufen, erhöht die Gefahr von Baumverlusten, hohen Schadenersatzforderungen und der Zerstörung eines beliebten Umfeldes.
Es ist daher empfehlenswert, durch Experten nicht nur intensiv die Kronenbrüche aufzuarbeiten, sondern gleichermaßen die Windwürfe. Aspekte sind hierbei:
- Erkennen exponierter Windlagen durch Pflanzenverwendung und Architektur (s. Abb. 2)
- Aufzeigen risikoreicher Kronenentwicklungen, u.a. Reiterationstriebe, eingewachsene Rinden
- Absinken der Grundwasserstände mit nachfolgenden Trockenschäden
- Infektionen mit holzzerstörenden Pilzen durch unverträgliche Schnittmaßnahmen (s. Abb. 5)
- Schäden der Wurzelsysteme durch mechanische Eingriffe bei mangelndem Baumschutz
- Bodenversiegelungen und -verdichtungen
All diese Erkenntnisse sollten vollständig in vorhandene Baumkataster aufgenommen werden, um nicht nur dem Nachweis der Baumkontrolle zur Herstellung der Verkehrssicherheit nachzukommen, sondern vielmehr die Grundlage für eine weitsichtige Baum- und Bestandsentwicklung zu liefern. Nur so können weitreichende Beeinträchtigungen und Verluste größerer Baumbestände durch den permanenten Stadtumbau oder Veränderungen der Wuchsbedingungen erkannt werden, z. B. durch Trockenheit, geringere Winterhärte und vermehrte Windbelastungen als Folge des Klimawandels.
Ein nachhaltiges Management der Baumbestände muss das Ziel haben, die Vitalität, Gesundheit und Stabilität der Gehölze möglichst genau zu kennen und auf dieser Datengrundlage alle baumbeeinflussenden Faktoren zu steuern. Unvermeidbare Eingriffe in die Baumsubstanz lassen sich so schadensmindernd optimieren und Baumverluste mittelfristig verringern.
Es ist daher bedenklich, dass die aktuellen Stürme in Berlin offenbart haben, dass viele Sturmschäden durch
- eine Überalterung der Baumbestände
- Folgen „baumchirurgischer“ Maßnahmen der Vergangenheit
- unzureichende Baumschutzmaßnahmen bei Bauvorhaben
- die Trockenheit der letzten Jahre
- wenig aufgearbeitete Sturmschäden der Vergangenheit
- eine nachlassende Baumpflege
- eine unzureichende Baumkontrolle
verstärkt oder sogar erst ermöglicht wurden. Es zeigt sich, dass die Fähigkeit zur verlässlichen Baumkontrolle und der sorgfältigen Dokumentation vielerorts nachgelassen hat. Dies ist eine Folge der unzureichenden Personalausstattung der Behörden, was die kommunale Politik aktuell mit einem Mangel an Fachpersonal erklärt (Berliner Morgenpost, 2025).
Da nachwievor Baumkontrolleure und Baumpfleger keine angemessen hochwertige staatliche Qualifikation erfahren, sind auch Dienstleister sehr unterschiedlich aufgestellt. Hieraus folgen leider auch zunehmend Angstfällungen von Bäumen und somit der Verlust kühlender Großbäume sowie der Finanzwerte geschaffener Investitionen in die grüne Infrastruktur (Bundesstiftung Baukultur, 2024).
In Hinblick auf die zunehmende Gefährdung der bedeutenden Altbaumbestände ist unbedingt eine intensivere Betreuung der Bäume erforderlich. Das Markenzeichen „Grüne Infrastruktur“ im Sinne des Weißbuches Stadtgrün „Grün in der Stadt – für eine lebenswerte Zukunft“ (BMU, 2017) erhält so seine wahre Identität.
Vorbeugen ist besser als heilen – Nach dem Sturm ist vor dem Sturm
Aus bisherigen und neuen Erkenntnissen ergeben sich drei Handlungsfelder für ein nachhaltiges Baummanagement unter sich verschärfenden Rahmenbedingungen:
- Nachsorge der sturmgeschädigten Baumbestände
- Vorbeugende Maßnahmen zur Stabilisierung der vorhandenen Baumbestände
- Anpassung der künftigen Grünplanungen für eine resiliente Bepflanzung im Lebenszyklusmodell und kalkulierten Pflegekosten
Kronenschäden müssen zeitnah aufgearbeitet werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Dabei sollte auch die Ästhetik des Ortes gesehen werden, um schrittweise wieder ein ansprechendes Ortsbild zu entwickeln. Die Baumkontrollen müssen in derartig geschädigten Baumbeständen intensiviert werden.
Wurden geschädigte Baumbestände abgesperrt, können sie erst wieder nach bestätigter Verkehrssicherheit frei gegeben werden.
Als wichtige Erkenntnis ist zu sehen, dass Baumbestände, die in risikoreichen Situationen in ihrer Entwicklung rechtzeitig in ihrer Kronengröße fachgerecht reduziert wurden, kaum Sturmschäden erlitten haben. In Berlin ist neben dem Kurfürstendamm und der Puschkinallee die angepasste Baumpflege der Platanen im Märkischen Viertel ein wegweisendes Beispiel. Mit Gründung des Stadtquartiers wurde zu Beginn der 70er Jahre ein Freiraumkonzept realisiert, dass 22 000 Platanen in einem sehr engen Pflanzabstand in größtenteils versiegelten und durch die Bebauung verschatteten Standorten vorsah.


Abb. 6: Platanen im Märkischen Viertel ohne Konzeptanpassung
In der Folge gab es großflächige Fehlentwicklungen (Abb. 6), so dass ein differenziertes Baumpflegekonzept mit mehrstufigen Kroneneinkürzungen für die Wohnungsbaugesellschaft in enger Abstimmung mit dem Grünflächenamt des Bezirkes entwickelt wurde.
Bis heute werden u.a. in regelmäßigen Abständen Kronenpflegemaßnahmen von Fachfirmen durchgeführt, so dass die Qualität der Freiräume für unterschiedliche Orte gewahrt ist (Abb. 7). Insbesondere die aktuellen Stürme mit nur vereinzelten Astbrüchen bestätigen die bisherige Vorgehensweise.


Abb. 7: Platanen im Märkischen Viertel mit intensiven Kronenpflegemaßnahmen
Fazit
Im urbanen Wohnumfeld sind neben der Anpassung der aktuellen Grünkonzepte zur Steigerung der Resilienz vorbeugende Baumpflegemaßnahmen im Klimawandel nachdrücklich zu empfehlen, um die Stabilität von risikoreichen Baumbeständen zu erhöhen und die Gefahr von Kronenbruch und Windwurf zu mindern.
Es geht der Appell insbesondere an die Wohnungswirtschaft, die Resilienz der Baumbestände zu überprüfen und mit geeigneten korrigierenden Maßnahmen zu reagieren, um nicht beim nächsten Sturm noch größere Probleme zu haben.
Literatur
- Balder, H., 1998: Die Wurzeln der Stadtbäume. Ulmer Verlag. Stuttgart
- Balder, H., 2005: Baumschäden durch Windbruch.
- Teil 1: vorbeugende Baumpflege. AFZ, 868-870
- Teil 2: Maßnahmen im Schadensfall. AFZ, 1096-1098
- Balder, H.; Reuter, A.; Semmler, R., 2009: Handbuch zur Baumkontrolle. 2. Auflage. Patzer Verlag. Berlin
- Berliner Morgenpost, 2015: Experte fordert bessere Baumkontrollen (14.07.2015
- BMU, 2017: Weißbuch Stadtgrün. Berlin
- Bundesstiftung Baukultur, 2024: Baukultur Bericht Infrastrukturen. Potsdam
- FLL, 2020: Baumkontrollrichtlinien. Bonn
- Stiftung DIE GRÜNE STADT, 2013: Bäume und Pflanzen lassen Städte atmen. Berlin
- Wessolly, L.; Erb, M., 2014: Baumstatik und Baumkontrolle. Patzer Verlag. Berlin