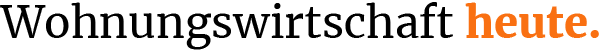Die Entwicklung eines Quartiers ist ein langer Prozess. Eine Bürgerbeteiligung bremst Projekte häufig, aber dafür entstehen bedarfsorientierte Konzepte. Erste Erfahrungen zeigen, in partizipativ entwickelten Projekten steigen sowohl Identifikation als auch soziale und urbane Resilienz.
WOJCIECH CZAJA
„Natürlich hat die Gstätten so nicht bleiben können“, sagt Lina Streeruwitz, „und natürlich braucht es einen Veränderungsprozess, um den Freiraum nach Bauvorschrift und geltender Norm zu planen. Dennoch war unser Ziel von Anfang an, möglichst viel Wildnis zu erhalten.“ Der erste Teil der sogenannten „Freien Mitte“ auf dem Areal des aufgelassenen Wiener Nordbahnhofs ist bereits fertiggestellt – mit Trockenwiesen, schütteren Staudenflächen und jeder Menge Silberpappeln.
Mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern – rund die anderthalbfache Fläche des Wiener Stadtparks – entsteht hier in den kommenden Jahren nicht nur Wiens größter Neubaupark, sondern auch ein nahezu naturbelassenes Habitat für Mensch, Fauna und Flora. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist einer offenen Bürgerbeteiligung zu verdanken. In Zusammenarbeit mit Land in Sicht und Agence Ter führte das Studio Vlay Streeruwitz ab Herbst 2013 einen monatelangen Partizipationsprozess durch und lud Menschen aus der Umgebung dazu ein, in Workshops die städtebauliche Konfiguration der Freien Mitte zu planen.
Künftige und bestehende Mieter sowie Gewerbetreibende aus den umliegenden Grätzln konnten ihre Wünsche äußern und die Gebäudemassen und Freiflächen nach eigenen Vorstellungen verteilen. Am Ende siegte eine Art demokratisch sinnvollste Schnittmenge aus Natur, Mobilität und immobilienwirtschaftlichem Verwertungsdruck.
„In so einem Beteiligungsprozess poppen immer wieder auch Ideen auf, die unrealistisch oder nicht wirklich relevant sind“, meint Streeruwitz. „Aber dafür gibt es auch viele Impulse und Planungsvorgaben, die wir als Ortsfremde in dieser Art und Intensität wahrscheinlich nicht am Radar gehabt hätten.“ Als Beispiel nennt die Stadtplanerin die Anlegung von begrünten Vorgärten in der namentlich ohnedies schon aussagekräftigen Vorgartenstraße. Die Ideen der Bewohner wurden verfolgt und umgesetzt. Bis 2028 soll die Stadtwildnis am Nordbahnhof-Areal fertiggestellt werden.
Neue Wohnformen
„Den Ursprung von Bürgerbeteiligungsprozessen auf urbaner Ebene“, sagt Raimund Gutmann, Senior-Partner wohnbund consult „findet man in Wien in den Siebzigerjahren – und zwar im Planquadrat im 4. Bezirk. Die ersten Gespräche dazu fanden 1973 statt, die Umsetzung in Form von Hofzusammenlegungen zu einer 5.000 Quadratmeter großen Parklandschaft erfolgte 1977.“ Gutmann selbst ließ sich von diesem Projekt inspirieren: Sein erster urbaner Partizipationsprozess, erinnert er sich, war kurz darauf die Wohnhaus anlage Forellenweg in Salzburg, ein vom damaligen Bautenministerium in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt inmitten von 350 Wohnungen.
„Viel euphorische Aufbruchstimmung, viel Aufwand über drei Jahre, hunderte Beteiligte“, sagt Gutmann. „Aber es hat sich ausgezahlt. Wir haben nicht nur neue Wohnformen definiert, sondern auch wertvolle Infrastrukturen für den ganzen Stadtteil geschaffen.“ Ähnliche Erfahrungen machte er Jahre später auch in der solarCity Linz und im Stadtwerk Lehen in Salzburg. „Partizipation bedeutet Dialog, Wahrnehmung von Sichtweisen und im Idealfall Berücksichtigung unterschiedlicher Milieus – und mit alledem ist die Einbindung von Bürgern immer auch ein Mittel zur Identifikation und somit ein wichtiges Element sozialer und urbaner Resilienz.“
An genau diesem Begriff aber stoßen sich heute viele Experten. „Ich halte das Wort Bürgerbeteiligung für sehr problematisch, weil es viel voraussetzt“, sagt Sonja Gruber, die früher bei PlanSinn gearbeitet hat und heute als selbstständige Konsulentin vor allem für Beteiligungsarbeit und soziale Nachhaltigkeit im Wohnbau tätig ist. „Umso wichtiger sind für mich daher die Meinungen und Bedürfnisse jener Menschen, die eben nicht wählen dürfen oder die keinen offiziellen Status besitzen. Sie bringen oft wichtige Erfahrungen mit ein.“
Sozialräumliche Analyse
Dass sich der Einfluss von sozial schwächeren Gruppen in einem Prozess niederschlagen und zu mitunter unerwarteten Ergebnissen führen kann, beweist das Projekt „Reumädchenplatz“ am Reumannplatz in Wien-Favoriten. Auf Basis einer sozialräumlichen Analyse, bei der auch Mädchen, Jugendliche und Migrantinnen einbezogen wurden, entstand ein sehr feines, sensibles, emanzipiertes Projekt, das die Gebietsbetreuung in Zusammenarbeit mit der lokalen Agenda 21 realisierte: Der gesamte Platz wurde umgebaut, gleich neben dem famosen Eissalon Tichy entstand eine mit Bänken eingefasste „Mädchenbühne“, die mit jungen Frauen geplant und gebaut wurde und von einem ganzjährigen Bespielungsprogramm begleitet wird…