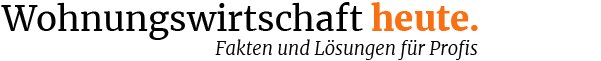Eine Betrachtung mit Berliner Perspektive von Friedrich Geschwinder
Der jüngst vom Bundeskabinett verabschiedete „Bau-Turbo“ verspricht in erster Linie eins: Erleichterungen für Bauherren und alle, die es werden wollen. Mit ihm soll Wohnbebauung in Einzelfällen auch ohne Bebauungsplan möglich und Nachverdichtung sowie Wohnen im Außenbereich einfacher werden. Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen verspricht eine Reduzierung der Planungszeit für den Wohnungsbau von fünf Jahren auf zwei Monate.
Doch setzt die neue Regierung hier an der richtigen Stelle an? Anfang 2024 formulierten die Bundesarchitektenkammer und der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten zusammen mit verschiedenen Umwelt- und Sozialverbänden einen Appell gegen die Einführung des damals noch von der Ampel-Regierung geplanten Bau-Turbos. Der Rückgang von Wohnungsneubauten habe nichts mit zu strengen Anforderungen der Baugesetze zu tun, so die Kernaussage. So seien zum Zeitpunkt des Appells erteilte Baugenehmigungen für fast 900.000 Wohneinheiten ungenutzt. Grund für das reduzierte Neubauvolumen seien damit nicht zu wenig erteilte Baugenehmigungen, sondern zu wenig genutzte Baugenehmigungen.
Gerade in Berlin zeigt sich dieses Paradoxon besonders deutlich. Laut Berliner Bauverwaltung wurden allein 2023 über 21.000 Wohnungen genehmigt, von denen ein erheblicher Teil bisher nicht realisiert wurde. Die Gründe dafür liegen tief in der Struktur der Bauprozesse sowie und im Spannungsfeld zwischen politischem Willen, wirtschaftlicher Realität und gesellschaftlichem Widerstand.
Baukosten steigen
Eine erste große Hürde für Bauherren sind die stetig steigenden Baukosten. Gerade in Berlin hat sich die Situation zugespitzt. Während der Bundesdurchschnitt laut Landesbausparkassen im Jahr 2024 bei bis zu 3.029 EUR pro Quadratmeter liegt, rangieren die durchschnittlichen Baukosten in Berlin laut Baukostenindex des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg sogar bei rund 3.250 EUR pro Quadratmeter.
Neben gestiegenen Material- und Energiekosten wirken sich auch die Preissteigerungen im Handwerk und die Anforderungen an nachhaltiges Bauen auf das Budget aus. Öffentliche Vorgaben wie die Solarpflicht oder höhere Energiestandards sind zwar ökologisch sinnvoll, erhöhen aber zusätzlich den finanziellen Druck. Angesichts der hohen Zinsen geraten viele Berliner Bauherren in Finanzierungsschwierigkeiten, was sich insbesondere bei privaten Bauträgern und kleineren Projektentwicklern zeigt.
Zwar gibt es Landesprogramme wie die „Wohnungsbauoffensive Berlin“, doch hier sind Antragsverfahren komplex und zeitaufwändig. Während auf dem Papier also Baugenehmigungen vorliegen, fehlt vielen Investoren die wirtschaftliche Basis, um ihre Projekte tatsächlich zu starten.
Personalmangel und Bearbeitungs-Slow Motion
Die Herausforderungen enden nicht bei der Finanzierung. In Berlin verzögern sich viele Projekte bereits auf Verwaltungsebene. Während das Baugesetzbuch bundesweit gilt, sind die Genehmigungsverfahren in Berlin besonders langwierig.
Laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine Baugenehmigung in Berlin über 8 Monate. Das stellt im Bundesvergleich einen Spitzenwert dar.
Parallel bremst der fortwährende Fachkräftemangel Baufirmen aus. In einer Umfrage der deutschen Industrie- und Handelskammer gaben 2024 53 % der Unternehmen an, Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung zu haben. Im Tiefbau waren es sogar 61 %. Während also im Wohnungsbau die Anzahl der Aufträge für Bauunternehmen in jüngster Vergangenheit gestiegen ist, haben viele Firmen zu wenig Kapazitäten, diese zu bearbeiten. Die Folge sind lange Wartezeiten und Baustopps, die die Fertigstellung bereits genehmigter Bauvorhaben verzögern.
Fällt erst mal ein Bauunternehmen bei der zeitlichen Planung eines Bauvorhabens aus, kann das gesamte Bauvorhaben wie ein Kartenhaus ineinander zusammenfallen. Baustellen stehen temporär still, zusätzliche Unterhaltungskosten fallen an und Bauherren müssen Nachunternehmer kurzfristig zu erhöhten Preisen beauftragen.
Nicht vor meiner Haustür
Ein weiterer Grund für Verzögerung nach erteilter Baugenehmigung sind Streitigkeiten mit Nachbarn.
Seit vielen Jahren versuchen Gemeinden, Wohnraum durch nachträgliche Nachverdichtung von Wohngebieten zu schaffen. Investoren, die auf frei gewordenen Grundstücken große Wohnraumprojekte verwirklichen möchten, werden daher mit offenen Armen empfangen. Doch nicht jeder ist ein Freund der typischen Neubauquartiere mit ihren Tiefgaragen, dunklen Ziegelsteinoptiken und bodentiefen Fenstern. Gerade in Wohngebieten, deren Bebauung zuvor nur von Ein- bis Zweifamilienhäusern geprägt war, haben Nachbarn Bedenken gegen die wortwörtlich aus der Reihe fallenden Großbauprojekte.
Bei einem großen Teil der Mandate von Koenen Bauanwälte im öffentlichen Baurecht handelt es sich um Nachbarklagen. Typische Argumente gegen ein benachbartes Bauprojekt sind Schattenwürfe durch übergroße Gebäude, Erhöhung des Verkehrsaufkommens und hieraus resultierender Lärm und Parkplatzmangel, Einsichtmöglichkeiten in das eigene Grundstück durch künstlich erhöhtes Gelände sowie der befürchtete Verlust des Wertes des eigenen Grundstücks.
Bei einer störenden Baugenehmigung des Nachbarn führt der Widerspruchsweg zunächst zur zuständigen Behörde. Diese muss daraufhin die Baugenehmigung noch einmal auf der Grundlage der Argumente des Nachbarn überprüfen und entscheiden, ob diese noch einmal aufgehoben wird. Wie lange das dauert, hängt stark von der Auslastung und der Personalkraft der jeweiligen Behörde ab. Erfahrungsgemäß ist bei einem anwaltlich begründeten Widerspruch mit Wartezeiten von einem halben bis einem Jahr zu rechnen.
Gibt die Behörde dem Widerspruch nicht statt, kann der Nachbar gegen die Baugenehmigung klagen. Meist übersteigt die Dauer eines Klageverfahrens die Dauer des Widerspruchsverfahren. So geht aus dem Geschäftsbericht des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg aus 2024 hervor, dass die durchschnittliche Verfahrensdauer für allgemeine Klageverfahren der niedersächsischen Verwaltungsgerichte 2023 bei 17 Monaten lag, was mit dem Personalmangel in Hinblick auf Richter begründet wird.
Der Nachbar kann stets beantragen, dass die Baugenehmigung bis zur Entscheidung über deren Rechtmäßigkeit ausgesetzt wird. Über den entsprechenden Antrag wird zwar meist innerhalb einiger Monate entschieden, doch damit ist nicht automatisch das Hauptverfahren vor Behörde oder Gericht aus der Welt.
Natürlich kann der Nachbar trotzdem nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Bau seines Vorhabens beginnen, ohne den Verlauf der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren abzuwarten. Doch gerade vor dem Hintergrund steigender Kosten bedeutet dies Risiko.
Alle getätigten Investitionen wären letztlich verloren, wenn die Baugenehmigung nach Baubeginn noch von einem Nachbarn gekippt würde, ohne dass eine neue in Aussicht steht.
Die Genehmigung des Bauvorhabens ist also nur das erste Glied in einer langen Kette von Hürden, die Bauherren nehmen müssen. Es gilt, die Finanzierung fortlaufend sicherzustellen, den Zeitplan mit unterbesetzten Bauunternehmen zu koordinieren und Streitigkeiten mit Nachbarn zu lösen.
Hierfür hat der Bauherr nicht unbegrenzt Zeit. Wird eine Baugenehmigung nicht genutzt, verfällt sie nach drei Jahren. Auf diese Weise sind im Jahr 2024 ca. 29.000 Baugenehmigungen erloschen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Das ist der Höchststand seit 2002. Laut Berliner Bauaufsicht waren es allein in Berlin 3.200.
Die Regierung bleibt daher auch neben dem beschlossenen Bau-Turbo in der Pflicht, die Rahmenbedingungen für den Bau zu verbessern. Wenn die Hauptstadt ihre ehrgeizigen Pläne im Wohnungsbau erreichen will, dann braucht es dafür aus meiner Warte digitalisierte, personell aufgestockte Bauämter, vereinfachte Förderzugänge und eine gute Kommunikationskampagnen in beliebten Wohnvierteln, in denen Nachverdichtungen geplant sind.
Nur so kann sichergestellt werden, dass der Bauherr nach erfolgreichem Verfahren mit dem Bau beginnen kann – falls ihm bis dahin noch nicht die Lust dazu vergangen ist.
Friedrich Geschwinder