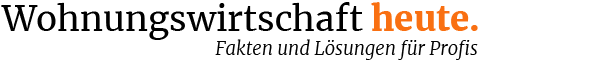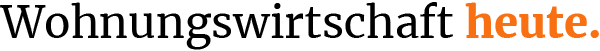Aus alt mach neu: Wo in Innenstädten Leerstand herrscht, ist zeitgleich Raum für Innovation. Das zeigt sich, wenn hinter grauen, leerstehenden Warenhausfassaden vielfältige Mixed-Use-Quartiere entstehen, eine alte Brauerei zu einer Eventlocation wird oder sich ein ehemaliger Bunker in ein modernes Wohngebäude verwandelt. Statt eines Abrisses präferieren Investoren sowie Städte und Gemeinden eine Umnutzung leerstehender Immobilien.
Hierin liegt zugleich die Chance, Missständen wie der anhaltenden Wohnungsknappheit zu begegnen und für mehr Attraktivität und Nachhaltigkeit in den Innenstädten zu sorgen.
Gerade Bauten in innerstädtischer Lage kommt dabei häufig ein großes Umnutzungs- und Entwicklungspotenzial zu. Doch der Weg zu einer Realisierung derartiger Projekte ist weit und meist gespickt mit rechtlichen Stolpersteinen und Hürden. Komplexe bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Abstimmungen und Genehmigungsvorgänge bremsen den Prozess oder rufen Probleme hervor. Auch zieht eine Umnutzung im Normalfall erhebliche bauliche Veränderungen am Bestandsgebäude mit sich.
Nur sorgfältige Planung und Koordinierung unter Einbeziehung von Stadtplanern, Architekten, Bauunternehmern und Rechtsberatern beugt unangenehmen Entwicklungen im rechtlichen, zeitlichen oder finanziellen Bereich vor.
Fall Boxhotel: Laborräume weichen Schlafboxen
Ein Fall, in dem die Nachnutzung letztlich geglückt ist, ist der des Boxhotels in Hannover. Die weitläufigen Räumlichkeiten, die sich nur wenige Gehminuten vom Hannoveraner Hauptbahnhof entfernt befinden, wurden einst für Laboranalysen genutzt. Heute nächtigen hier Geschäftsreisende, Traveller, Messebesucher und Fernpendler. Doch wie passen der Grundriss eines großräumig angelegten Labors und ein Hotel zusammen?
Die Idee hinter dem Boxhotel: 4,2 bis 5,3 m² große Schlafboxen. Anstatt eines Panoramablickes aus dem Fenster gibt es hier Lichtbilder, die von fernen Reisezielen erzählen. Frischluft führt den Boxen ein eigens entwickeltes, ausgeklügeltes Belüftungssystem zu. In den Fluren sorgt künstliches Tageslicht für ausreichend Helligkeit.
Die Unterschiede zu einem herkömmlichen Hotel sind groß ꟷ zu groß, wenn es nach dem Bauamt der Stadt Hannover ging. Völlig unerwartet lehnte das Bauamt den Antrag des Investors auf Erteilung der Baugenehmigung ab. Es sah durch die fensterlosen Schlafkabinen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht als gewahrt an. Hierfür berief es sich auf die Niedersächsische Bauordnung, nach der Aufenthaltsräume grundsätzlich über Fenster verfügen müssen, die ins Freie führen. Diese Entscheidung hob jedoch das Verwaltungsgericht Hannover auf.
Das Gericht entschied, dass fensterlose Räume für einen kurzen Aufenthalt in einem Hotel rechtlich zulässig sind. Es begründete seine Entscheidung damit, dass die Schlafboxen nicht dem Wohnen dienen, sondern eine reine Übernachtungsmöglichkeit darstellen.


Da das Boxhotel-Konzept anderweitig für ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz sorgt, konnte eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, sodass Gästen der Stadt nunmehr kostengünstige und moderne Schlafgelegenheiten in zentraler Lage zur Verfügung stehen.
Zu erwarten ist, dass andere Städte nachziehen. Vielerorts müssen in Innenstädten Lösungen, insbesondere für leerstehende Kaufhäuser, gefunden werden, um einer Verödung des Stadtzentrums entgegenzuwirken. Größte Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit kommt dabei sogenannten Mixed-Use-Konzepten zu. Das heißt, dass mindestens zwei Nutzungsarten miteinander kombiniert werden, so etwa Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss, Kultur- oder Sportangebot auf zweiter Ebene und in den oberen Etagen Büro-, Wohn- oder Hotelnutzung.
Mixed-Use-Nachnutzung in der Regel planungsrechtlich zulässig
Es stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine solche “Mischnutzung” überhaupt rechtlich zulässig ist. Ausgangspunkt weiterer Überlegungen zum Umbau ist dabei das vorherrschende Planungsrecht auf dem zu entwickelnden Grundstück. Betrachtet man leerstehende Warenhäuser in Innenstädten, so sind grundsätzlich zwei Konstellationen denkbar. In der ersten Konstellation liegt auf dem Grundstück ein qualifizierter Bebauungsplan oder zumindest ein einfacher Bebauungsplan mit Festsetzungen zur zulässigen Art der Nutzung vor. In der zweiten Konstellation befindet sich das Grundstück im sog. unbeplanten Innenbereich.
Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² – wozu insbesondere auch Warenhäuser gehören – sind grundsätzlich nur in Kerngebieten (der Regelfall der Festsetzung) oder Sondergebieten zulässig.
Kerngebiete nach § 7 BauNVO dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung oder Kultur. Daneben sind zudem Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig, ebenso wie Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetriebe. Das Wohnen hingegen ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn dies im Bebauungsplan explizit festgesetzt oder im Einzelfall durch die Baugenehmigungsbehörde zugelassen wird.
Zunächst ist also die Überlegung anzustellen, welches Nutzungskonzept verfolgt werden soll. Bei zunehmend beliebten Mixed-Use-Konzepten schließt sich die Frage an, ob diese auch Wohnnutzung beinhalten sollen.
Soll das Mixed-Use-Konzept eine gleichberechtigte Wohnnutzung vorsehen, ist es ratsam, auf die Kommune zuzugehen und die weitere Planung abzustimmen. Dies beruht auf dem Hintergrund des erst 2017 eingeführten Urbanen Gebiets nach § 6a BauNVO. Dieses dient sowohl dem Wohnen als auch der Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss dabei ausdrücklich nicht gleichwertig sein.
Nutzung muss sich in nähere Umgebung einfügen
Eine eher untergeordnete Rolle nimmt die Konstellation ein, in der ein Bebauungsplan nicht besteht, sondern das Grundstück sich im sogenannten unbeplanten Innenbereich befindet. Im sogenannten unbeplanten Innenbereich richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach § 34 Abs. 1 BauGB. Innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (Innenbereich) muss sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, was auch die geplante Nutzungsart umfasst.
Die „Eigenart“ der näheren Umgebung umfasst dabei alle städtebaulich relevanten Faktoren. Ein Bauvorhaben fügt sich daher erst dann ein, wenn es sich in jeder Hinsicht innerhalb des aus seiner Umgebung hervorgehenden Rahmens hält oder zumindest keine bodenrechtlich relevanten Spannungen begründet oder verstärkt.
Da gerade bei Mixed-Use-Konzepten vielfältige Nutzungsarten mit der umgebenden Bebauung harmonieren müssen, ist eine sorgfältige Prüfung des „Einfügens“ unumgänglich, um eine rechtssichere Planung zu erhalten. Bevor also vertieft in die Planung eingestiegen wird, sollte sich vorher gründlich mit dem Planungsrecht beschäftigt und sich mit den Möglichkeiten vertraut gemacht werden. Der enge Austausch mit dem zuständigen Planungsträger (Stadt oder Gemeinde) ist dabei grundsätzlich zu empfehlen.
Architekt muss Hausaufgaben machen
Neben der Genehmigungsfähigkeit der Nutzungsänderung dürfen Nachnutzungswillige auch die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Vorhabens nicht aus dem Blick verlieren. Ein essenzieller Punkt für einen Investor.
Hier birgt Bauen am Bestand ein besonderes Risiko. Häufig stellen sich, anders als anfangs vermutet, erst im Nachhinein weitergehende Umbaumaßnahmen als erforderlich heraus. Beispielsweise können aufgrund der statischen Sicherheit zusätzliche umfangreiche Maßnahmen erforderlich sein, die unter Umständen erhebliche Kosten mit sich bringen. Dann winkt eine reelle Gefahr der Kostenexplosion. Eine massive Überschreitung der Kalkulationen geschieht häufiger als angenommen.
Nur eine fachgerechte Grundlagenermittlung durch den Architekten senkt im Vorfeld das Risiko. Bei der Grundlagenermittlung handelt es sich um die erste der neun Leistungsphasen der Objekt- und Fachplanung der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure). In diesem Zuge blicken die Beteiligten in die Zukunft und stecken die Rahmenbedingungen für das Bauvorhaben ab. Der Architekt verpflichtet sich dabei zu einer Beratung zum gesamten Leistungsbedarf, wozu auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung zählt.
So wurde durch die Rechtsprechung festgelegt, dass der Architekt schon bei der Grundlagenermittlung auf eine kostengerechte Planung achten und den wirtschaftlichen Rahmen abklären muss. Er hat den Bauherrn als sichere Grundlage für seine Bauentscheidung über die voraussichtlichen Kosten des Bauvorhabens zu informieren.
Daneben trifft den mit dem Umbau eines Bestandsgebäudes beauftragten Architekten eine intensive Bauwerkserkundigungspflicht: Er hat zu prüfen, ob die vorhandenen Bauunterlagen und der Zustand des Gebäudes eine sichere Grundlage für das geplante Bauvorhaben sind. Dabei sollen die Probleme, die sich aus der Bauaufgabe, den Planungsanforderungen und den Zielvorstellungen ergeben, untersucht, analysiert und geklärt werden. Gegebenenfalls muss der Architekt auf standortbezogene Gefahren hinweisen und mit dem Bauherrn die möglichen Risiken des Bauvorhabens eingehend erörtern. Auf dieser Grundlage soll der Bauherr eine eigenständige Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen können.
Verletzt der Architekt die oben genannten Pflichten, also die Wirtschaftlichkeitsprüfung und/oder die Bauwerkserkundigungspflicht, und kommt es in der Folge zu einer Kostenexplosion, kann der Architekt gegebenenfalls auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass dem Bauherrn auch ein Schaden entstanden ist, für den die Pflichtverletzung des Architekten ursächlich war.
In der Vergangenheit haben Gerichte an den Nachweis an einen kausalen Schaden im Zusammenhang mit einer nicht ordnungsgemäßen Grundlagenermittlung des Architekten hohe Anforderungen gestellt. Im Einzelfall geht es darum, ob der Bauherr bei einer ordnungsgemäßen Beratung vor Aufnahme der Bauarbeiten von dem Umbauvorhaben Abstand genommen und sich für den Abriss des Bestandsbaus und einen Neubau entschieden hätte. Der Nachweis hierüber wird oft schwer zu erbringen sein.
Aus diesem Grund ist es als Bauherr umso wichtiger zu überprüfen, dass der Architekt direkt zu Beginn der Architektenleistung „seine Hausaufgaben macht“, seinen Beratungs- und Erkundigungspflichten umfänglich nachkommt und über die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens aufklärt.
Charlotte Peitsmeier
Prof. Dr. Andreas Koenen